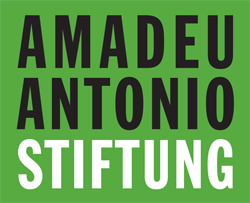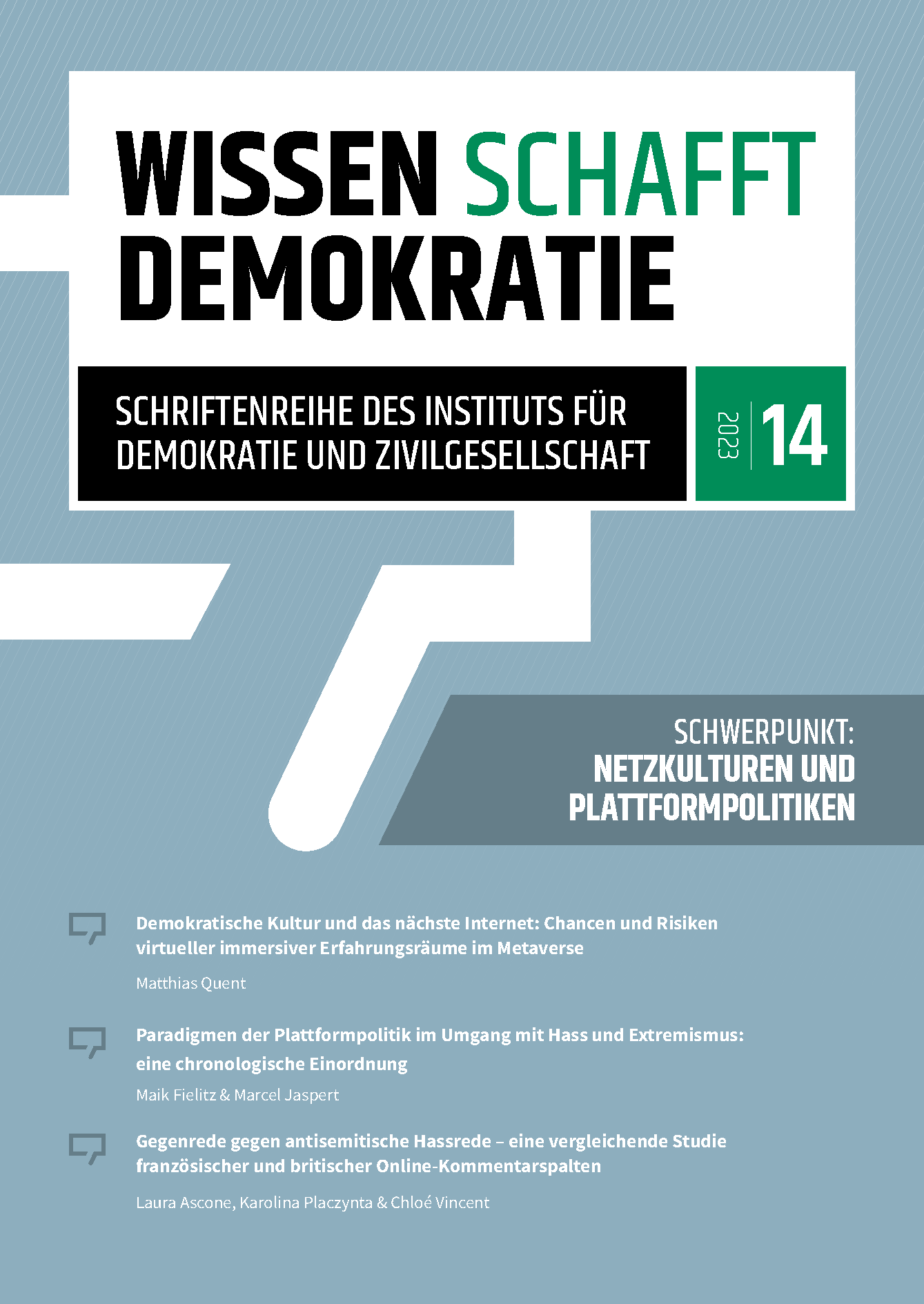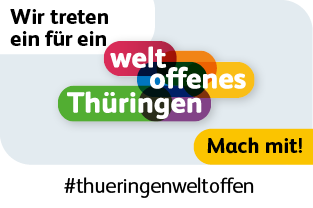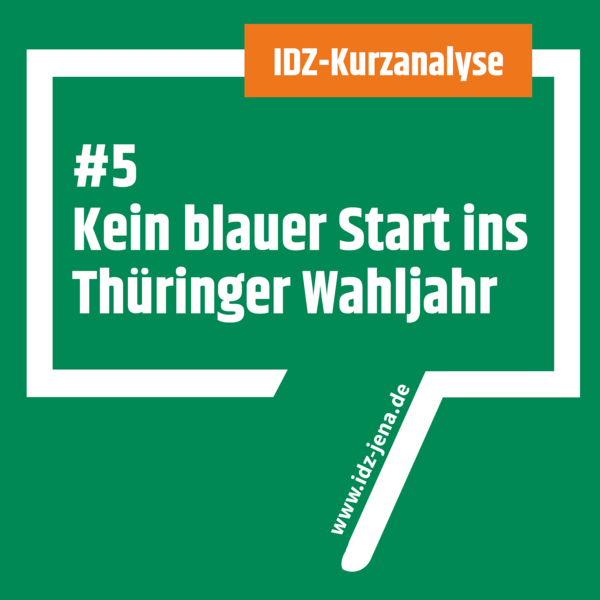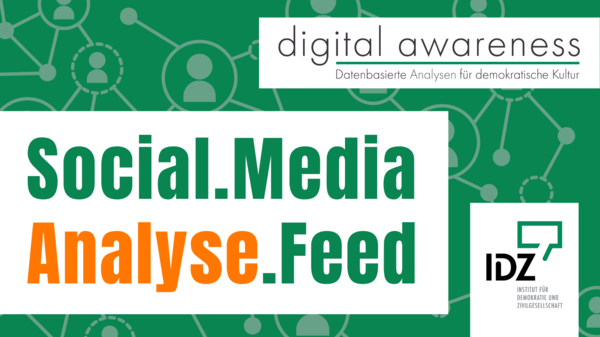Unsere Veranstaltungen
Lesung und Diskussion mit Hrsg. Stefan Lauer & Beitragsautorin Merle Stöver
Online-Diskussion im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Heftes der Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung (ZRex, Jg. 4, Heft 1)
Die Brandmauer gegen die extreme Rechte in der Lokalpolitik und im Diskurs
Foyergespräch zum Wahljahr 2024 im Deutschen Nationaltheater Weimar und im Livestream
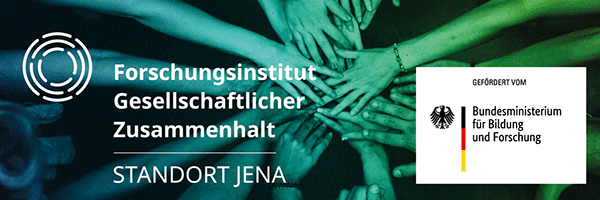
BMBF-Projekt Institut Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Aktueller Band der IDZ-Schriftenreihe "Wissen schafft Demokratie" mit dem Schwerpunkt: Netzkulturen und Plattformpolitiken
Wir unterstützen das thüringenweite Bündnis
Neuigkeiten
Die 7. Ausgabe der ZRex (Jg. 4, Heft 1) ist soeben erschienen und nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Honorarkraft zur wissenschaftlichen Mitarbeit gesucht
Für eine Studie zu „Jüdischen Perspektiven in Ostdeutschland“ sucht die Amadeu Antonio Stiftung für das IDZ eine Person zur wissenschaftlichen Mitarbeit auf Honorarbasis im Zeitraum vom 01.04.2024 bis zum 31.05.2024. Wir freuen uns über Angebotseinreichungen bis zum 24.03.2024. Die Studie ist Teil des Forschungsprojekts „Diversität – Engagement – Zusammenhalt: In- und Exklusionserfahrungen gesellschaftlich marginalisierter Gruppen“.
Im zweiten Teil der Analyse "Klimabewegung Online" zeigten wir auf, dass die untersuchten Akteur*innen der Klimabewegung für den Klimavolksentscheid nicht übergreifend mobilisieren konnten. Der Volksentscheid und mit ihm auch ein progressiver realpolitischer Klimaplan scheiterten. Um die Konstellationen von politischen Gruppen, Für- und Gegensprecher*innen und deren inhaltliche Vernetzung im Diskurs aufzeigen zu können, haben wir im dritten Teil die Debatte um den Volksentscheid exemplarisch auf X (ehemals Twitter) mittels des Twitter-Explorers in einem Retweet-Netzwerk untersucht.
Digital Awareness Analyse: #6 Klimabewegung Online – Ein digitales Panorama. Teil 2: Inhaltlich-kommunikative Vielfalt
Im zweiten Teil des Online-Berichts soll es darum gehen, wie die unterschiedlichen Akteur*innen der Klimabewegung kommunizieren. Welche Themen werden behandelt und vor allem wie werden diese angesprochen? Sind unterschiedliche Kommunikationsstrategien auszumachen und welche Sprache, Bilder und Emotionen sind bei welchen Zielen und Aktionen mehr oder weniger „erfolgreich“ auf den untersuchten Social-Media-Kanälen?
Die Demonstration ist auch in Thüringen eine der attraktivsten und akzeptiertesten politischen Beteiligungsformen. Allerdings hat dies in den letzten Jahren immer wieder die Frage aufgeworfen, inwieweit der Protestdynamik auf den Straßen und Plätzen des Freistaats auch ein antidemokratisches Potenzial innewohnt. Wir haben analysiert, welche Protestereignisse in der öffentlichen Berichterstattung auf den Webportalen der vier auflagen- und leser*innenstärksten Thüringer Zeitungen im Zeitraum vom 1. August 2022 bis 31. Mai 2023 abgebildet wurden und welche Protestdynamik daraus ablesbar ist.
Am 30.1.2024 wurde der aktuelle Band der IDZ-Schriftenreihe "Wissen schafft Demokratie" zum Schwerpunkt "Netzkulturen und Plattformpolitiken" veröffentlicht und Vertreter*innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Der Kurzbericht zum Roundtable liegt nunmehr vor.
Das Institut
Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit dem Ziel, die demokratische Kultur und Zivilgesellschaft in Thüringen und darüber hinaus zu stärken.
Zentrale Aufgabe des Instituts ist es, Wissenslücken über demokratiefeindliche und -gefährdende Phänomene, Strukturen und Bewegungen zu identifizieren und durch wissenschaftliche Untersuchungen zu schließen. Das IDZ begreift sich als Ort der öffentlichen Sozialforschung, in dem der Erkenntnisgewinn und -transfer zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik einen zentralen Platz einnimmt.
Das 2016 gegründete Institut befindet sich in Trägerschaft der Amadeu-Antonio-Stiftung und wird gefördert durch das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Seit dem 01. Juni 2020 ist das IDZ zudem einer von bundesweit elf Standorten des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ).
Medienmeldungen
# 5 - Janine Dieckmann und Leon Reichle vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft
Campus Radio Jena /mit Janine Dieckmann und Leon Reichle
Rassismus und Angriffe auf unsere Demokratie sind aktuell präsenter denn je. Damit der Protest nicht nur auf den Straßen stattfindet, setzt sich auch die Forschung mit rassistischen Strukturen auseinander. Dr. Janine Dieckmann und Dr. Leon Rosa Reichle erforschen innerhalb ihres angewandten Teilforschungsprojekts “Innerbehördliche Auseinandersetzung mit Rassismus” Strukturen in Polizei- und Sozialverwaltungsbehörden.
UN-Wochen gegen Rassismus: „Menschenrechte sind für alle da“
FR /mit Leon Reichle
Die UN-Wochen gegen Rassismus sind gestartet. Eröffnet werden sie im thüringischen Erfurt. Thüringen ist im Superwahljahr und kämpft zunehmend mit dem Erstarken rechter Gruppen.
NTV /mit Axel Salheiser
Das Oberverwaltungsgericht Münster entscheidet in Kürze, ob die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden darf. Rechtsextremismus-Experte Axel Salheiser hält es für wahrscheinlich, dass die Partei ihre Klage verliert. Ein Ende des juristischen Streits ist dennoch nicht zu erwarten: "Zunächst einmal würde die AfD das Urteil anfechten. Dann geht es in die nächste Instanz, ans Bundesverwaltungsgericht, und schließlich an das Bundesverfassungsgericht, bei dem die Verfahrensprüfung liegen würde."
Publikationen und Schriftenreihe
Forschungsbericht: Zivilgesellschaft in Bewegung: Protestereignisse in Thüringen 2022/23 im Spiegel der Presseberichterstattung
Die Demonstration ist auch in Thüringen eine der attraktivsten und akzeptiertesten politischen Beteiligungsform. Allerdings hat dies in den letzten Jahren immer wieder die Frage aufgeworfen, inwieweit der Protestdynamik auf den Straßen und Plätzen des Freistaats auch ein antidemokratisches Potenzial innewohnt. Wir haben analysiert, welche Protestereignisse in der öffentlichen Berichterstattung auf den Webportalen der vier auflagen- und leser*innenstärksten Thüringer Zeitungen im Zeitraum vom 1. August 2022 bis 31. Mai 2023 abgebildet wurden und welche Protestdynamik daraus ablesbar ist.
IDZ-Kurzanalyse: Kein blauer Start ins Thüringer Wahljahr. Analyse zur Landratswahl 2024 im Saale-Orla-Kreis
Der Ausgang der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis blieb bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Stichwahl spannend. Mit 52,4% der Stimmen setzte sich der CDU-Kandidat Christian Herrgott nur knapp gegen den AfD-Kandidaten Uwe Thrum (47,6%) durch. Der Zusammenhalt der Demokrat*innen in der Region konnte letztlich ein AfD-Landrat verhindert und der von der AfD erhoffte Auftaktsieg zu Beginn des Wahljahres 2024 blieb aus. Doch im knappen Ergebnis und in den Stimmenzuwächsen für Thrum zeigt sich weiterhin die weitfortgeschrittene Erosion eines demokratischen Konsenses in der Gesellschaft.
Forschungsbasierter Wissenstransfer und gesellschaftlicher Zusammenhalt: Theorie, Empirie, Konzepte und Instrumente
Der Begriff des Gesellschaftlichen Zusammenhalts ist vieldeutig, sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in den Sozialwissenschaften. Daher stellt sich die Frage, wie der wechselseitige Wissenstransfer zw. Forschung, Zivilgesellschaft und Politik gelingen kann. Der Band diskutiert, mit welchen Methoden gesellschaftlicher Zusammenhalt heutzutage erforscht wird und unter welchen Bedingungen forschungsbasierter Wissenstransfer zur Beantwortung gesellschaftl. Fragen und Probleme eingesetzt werden kann. Herausgegeben von Mitarbeiter*innen der FGZ-Standorte: Halle, Hannover, Bremen und Jena.
Rechtsextremismus im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Strukturen, Akteur*innen, Räume und Aktivitäten
Rechtsextreme Symbole im öffentlichen Raum, Neonazi-Szenebekleidung als Selbstverständlichkeit im Alltag, Angriffe auf nichtrechte Jugendliche und Migrant*innen, zerstörte Regenbogenfahnen, bekannte rechtsextreme Akteur*innen bei den nach wie vor regelmäßig stattfindenden Montagsdemonstrationen, die andernorts in Deutschland längst keine wahrnehmbare Rolle mehr spielen – Rechtsextremismus ist Teil der Normalität im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
IDZ-Kurzanalyse: Deutschland nach dem 7. Oktober – kein Zusammenhalt gegen Antisemitismus?
Am 7. Oktober überfiel die radikalislamische Terrororganisation Hamas Israel. Über Land-, See- und Luftweg drangen Terroristen nach Israel ein und begingen grausame Verbrechen, überwiegend an der israelischen Zivilbevölkerung. Beim schlimmsten antisemitischen Pogrom in diesem Jahrhundert wurden Menschen in ihren Siedlungen und auf offener Straße erschossen, in ihren Häusern angezündet, enthauptet, gefoltert und verschleppt. Viele Frauen wurden brutal vergewaltigt und dann getötet, teilweise vor ihren eigenen Kindern. Während junge Menschen beim Super-Nova-Festival in der Wüste wenige Kilometer…