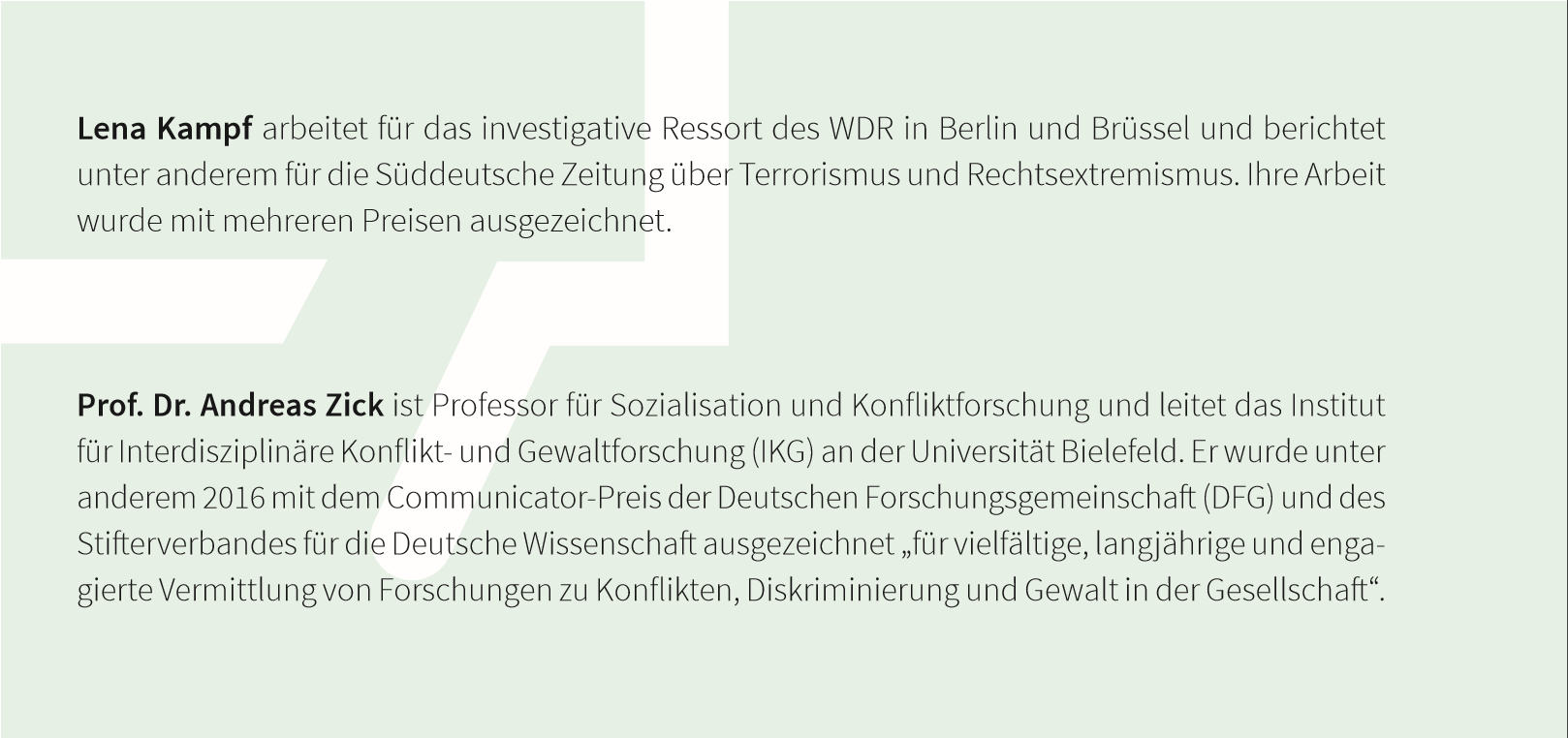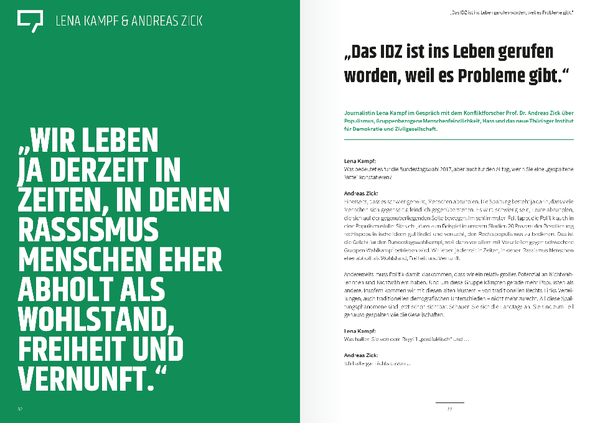Lena Kampf:
Was bedeutet es für die Bundestagswahl 2017, aber auch für den Alltag, wenn Sie eine „gespaltene Mitte“ konstatieren?
Andreas Zick:
Einerseits, dass es schwieriger wird, Menschen abzuholen. Die Spaltung besteht ja darin, dass viele Menschen sich gegenseitig feindlich gegenüberstehen. Es wird schwierig sein, Leute abzuholen, die sich auf der gegenüberliegenden Seite bewegen. Im schlimmsten Fall tappt die Politik auch in eine Populismusfalle. Sie sieht, dass zum Beispiel in unseren Studien 20 Prozent der Bevölkerung rechtspopulistische Ideen gut findet und versucht, den Rechtspopulismus zu bedienen. Das ist die Gefahr für den Bundestagswahlkampf, weil dann vor allem mit Vorurteilen gegen schwächere Gruppen Wahlkampf betrieben wird. Wir leben ja derzeit in Zeiten, in denen Rassismus Menschen eher abholt als Wohlstand, Freiheit und Vernunft.
Andererseits muss Politik damit klarkommen, dass wir ein relativ großes Potenzial an Nichtwählerinnen und Nichtwählern haben. Und um diese Gruppe kämpfen gerade mehr Populisten als andere. Insofern kommen wir mit diesen alten Mustern – von traditionellen Rechts-Links-Verteilungen, auch traditionellen demografischen Unterschieden – nicht mehr zurecht. All diese Spaltungsphänomene sind jetzt schon sichtbar. Schauen Sie sich die Landtage an. Sie sind zum Teil genauso gespalten wie die Gesellschaften.
Lena Kampf:
Was halten Sie von dem Begriff „postfaktisch“ und …
Andreas Zick:
Ich halte gar nichts davon ...
Lena Kampf:
… wenn es keine Erkenntnis mehr gibt, die als wahr angenommen wird, ist dann nicht Aufklärung und Wissenschaft, die sich einmischt, obsolet?
Andreas Zick:
… weil er eine Falle enthält: Wir beschäftigen uns dann mit Wahrheiten und der Frage, was wahr ist. Das kann eine Falle sein. In der Forschung über Vorurteile gibt es keine Wahrheiten: Es gibt Unentdecktes, es gibt Widersprüche, es gibt unterschiedliche Theorien, mit denen man zu unterschiedlichen Interpretationen kommt. Das heißt, letztendlich muss ich im Stande sein, kompetent über Sachverhalte unterschiedlich zu reflektieren. Das verhindert eine reine Diskussion über das Postfaktische, weil wir uns dann im Wahrheitsdiskurs verfangen.
Der Begriff wäre wissenschaftlich wie journalistisch dann interessant, wenn wir uns mit dem Phänomen beschäftigen, wie Gruppen ihre eigenen Wahrheitswelten bauen und was sie damit bezwecken. Wir können uns damit beschäftigen, wie Echoräume konstruiert werden und wie sie funktionieren. Aber wenn wir uns nur damit beschäftigen, was Wahrheit ist, landen wir in einer Falle.
Für mich ist die Frage, wie wir mit Populismus umgehen, wie er funktioniert und warum viele Menschen bereit sind, anderen ‚Wahrheiten‘ zu glauben, eigentlich interessanter.
Lena Kampf:
Sie erforschen in Bielefeld Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Der Hass und die Konflikte werden in Deutschland jedoch zunehmend heterogener. Wie kann Wissenschaft da Schritt halten, mit welchen Methoden kann dies untersucht werden, über eine reine Dokumentation hinaus?
Andreas Zick:
In Bielefeld versuchen wir die Phänomenbereiche erst mal relativ gut zu definieren. Eine gute Definition kann streitbar sein, aber damit haben wir relativ klar im Blick, was eigentlich zentral ist für die unterschiedlichen Formen von Extremismus und Populismus, die wir sehen. Und da sind wir mit dem Konzept Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) relativ weit gekommen, weil wir sagen: Letztendlich sind die Ideologien von Ungleichwertigkeit das Scharnier in vielen Formen der Abwertung und Feindseligkeit gegenüber Gruppen. Hinter Phänomenen wie Vorurteilen steht das Motiv von Gruppen, andere als ungleichwertig zu definieren.
Mit dem Blick auf die Frage, was Rechtsextremismus ist, wird es komplizierter, weil die Erscheinungsformen rechtsextremer Gruppen heterogen sind. Wir beobachten rechtsextremen Terror, rechtsextrem organisierte Gruppen, Einzelpersonen, wie den Attentäter auf die Oberbürgermeisterin von Köln oder moderne selbst gebastelte rechtsextreme Gruppen. Wir haben rechtsextreme parteiförmige Formen, in der NPD, Teile in der AfD. Und dann beobachten wir seit vielen Jahren rechtsextreme Orientierungen in der Gesellschaft unter Menschen, die es zurückweisen würden, dass sie rechtsextrem sind. Es sind unterschiedliche Meinungselemente und Facetten des Rechtsextremismus, die tief in der Mitte der Gesellschaft verankert sind.
Drittens beobachten wir, dass GMF die Grundlage moderner rechtspopulistischer Orientierungen ist. Auch hier spielt die Ungleichwertigkeit eine zentrale Rolle, wenn auch im Vergleich zum Rechtsextremismus die Gewalt und die Rechtfertigung, das System mit Gewalt infrage zu stellen, nicht das zentrale Element ist. Und von dort aus kommen wir dann in den Bereich von neu-rechten Ideologien.
Trotz aller Unterschiedlichkeit und Vielfalt menschenfeindlicher Ideologien kommt man über die Analyse von Ideologien der Ungleichwertigkeit und die Frage, wie sie immer wieder in den Zeitgeist, in die unterschiedlichen Milieus eingepasst werden, relativ gut zurecht. Neben der Frage nach einer guten Definition, ist dabei auch immer die Frage zu stellen: Was will ich eigentlich warum wissen?
Lena Kampf:
Warum sprechen Sie von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und nicht von Rassismus?
Andreas Zick:
Weil ich nicht immer ad acta legen kann, was Forschungstradition ist. Das, was wir erforschen, muss anschlussfähig sein und nicht alles, was wir an menschenfeindlichen Meinungen, Emotionen und Verhaltensweisen beobachten, ist rassistisch. Es kann auch eine Feindseligkeit gegenüber Gruppen sein, die darauf beruht, dass die abgewertete Gruppe als ‚anders‘ oder ‚unterschiedlich‘ wahrgenommen wird. Es kommt aber darauf an, in welchem Diskursbereich ich mich bewege. Andere ForscherInnen haben einen weite Definition von Rassismus, die jene Abwertungen, die wir beobachten, als Rassismus bezeichnen. Was wir in Bielefeld als Rassismus diskutieren, sind klassische und moderne Formen des Rassismus. Klassischer Rassismus beruht auf der Ausgrenzung von anderen Menschen aufgrund von Merkmalen, die scheinbar natürlich sind, scheinbar biologisch sind, auf jeden Fall Merkmale, die eine Person oder eine Gruppe nicht ablegen kann. Es gibt Rassismus, es gibt rassistische Muslimfeindlichkeit, es gibt alle Elemente von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in einer rassistischen Variante, in traditioneller Variante, also eine Abwertung aufgrund von biologischen Zuschreibungen. Moderner Rassismus ist subtiler und erscheint nicht als rassistisch. Dazu gehört zum Beispiel die Abwertung von Gruppen, weil sie als kulturell anders und fremd wahrgenommen werden, als wenn Kultur ein Naturmerkmal wäre.Schließlich forschen wir auch zu subtilen Vorurteilen oder Menschenfeindlichkeiten. Sie erweisen sich zum Beispiel darin, anderen Personen oder Gruppen positive Eigenschaften vorzuenthalten. Subtile Abwertungen zeigen sich auch in benevolenten Vorurteilen: Es ist eine positive Diskriminierung, man schreibt ihnen etwas Positives zu – zum Beispiel beim benevolenten Sexismus, wenn ich behaupte, Frauen könnten sich besser um Kinder kümmern, um ihnen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu nehmen. Bei der Analyse solcher Formen wird der Rassismusbegriff schwierig. Denken wir zum Beispiel auch an moderne Formen des israelbezogenen Antisemitismus oder die Abwertung von Wohnungslosen, Arbeitslosen und anderen Gruppen. Verstehe ich die Ausdrucksformen besser, wenn ich einen Einheitsbegriff verwende?
Lena Kampf:
Von Hartz-4-Empfänger …
Andreas Zick:
Ja, auch das. Auch hier gibt es Rassismus, wenn ich Hartz-4-Empfänger wie eine ‚Rasse‘ verstehe, aber auch in Bezug auf diese Gruppe gibt es Vorurteile, die sich keines expliziten oder impliziten Rassismus bedienen müssen. Ich finde also die Begriffe Vorurteil und Menschenfeindlichkeit praktisch, und sie verstellen meines Erachtens nicht den Blick auf die Hintergründe.
Lena Kampf:
Warum erscheint es in Deutschland noch immer so schwer, über Rassismus zu sprechen, Rassismus zu benennen?
Andreas Zick:
Ich glaube nicht, dass das so schwer ist für die Forschung oder NGOs. Schwierig ist es für Menschen, die sich rassistisch äußern, aber nicht erwischt werden sollen. Schwierig ist es auch, weil wir mit der Rassetheorie des Nationalsozialismus und der Vernichtung von Menschen, weil sie Rassen zugeordnet wurden, nicht mehr leichtfertig mit dem Begriff umgehen können. Aber es tut sich was. Wir haben einen Nationalen Aktionsplan, an dem ich jetzt mitgearbeitet habe, wo wir auch über Rassismus berichten und die Ideologie, mit dem Ende des Nationalismus sei der Rassismus beendet, keine Rolle mehr spielt.
Lena Kampf:
Aber nehmen wir nur den letzten Silvestereinsatz der Polizei in Köln. Offenbar hatte die Polizei keine andere Strategie, als Männer, die augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft waren, auszusondern. Das ist Racial Profiling. Warum kann das nicht als solches benannt werden?
Andreas Zick:
Man muss das benennen, aber wir müssen auch behutsam mit dem Rassismusvorwurf umgehen und die Situation und mögliche alternative Sichtweisen bedenken. Polizeien versuchen und müssen sich professionell und rechtlich richtig verhalten. Rassistisches Handeln wäre eine Verletzung der Dienstpflicht und ein Straftatbestand und daher wiegt die Annahme von Rassismus schwer und wird geblockt. Das erklärt einen Teil der reflexhaften Abwehr von Rassismusvorwürfen. Zudem haben wir in Deutschland kein gutes Konzept von Hate Crimes, das es erleichtert, vorurteilsbasiertes oder rassistisches Handeln leichter nachzuweisen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Fall in verschiedenen Bundesländern vollkommen unterschiedlich behandelt wird. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche in den Polizeien sehr genau wissen, was Racial Profiling ist, sonst würden sie nicht so allergisch reagieren. Zudem sind viele Behörden aus sich selbst heraus nicht in der Lage, über Racial Profiling zu reden. Das ist bei deutschen Gerichten ähnlich, wenn man mal in den deutschen Gerichtsalltag schaut. Auch in den USA wird in der Kriminologie dazu geforscht. Amerikanische Kollegen schlagen vor, von Bias Crimes zu sprechen. Davon sind wir nicht so weit entfernt. Es verwundert also nicht, dass Deutschland immer wieder in die Verantwortung genommen wird, Menschenfeindlichkeit und Rassismus genauer nachzugehen und dazu muss man sie genau definieren.
Lena Kampf:
Kein klares Konzept bedeutet dann aber auch, dass es ein besonders großes Problem gibt?
Andreas Zick:
Ja, denn es werden einfach Taten übersehen. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel für die Ignoranz. Wir haben das im Bereich Fußball untersucht: Da haben wir Schiedsgerichtsurteile im Amateurfußball analysiert. Wir haben festgestellt, dass Spieler mit einem nichtdeutschen Namen, also mit einem Namen, der auf Migrationsgeschichte hinweist, bei stärkeren Vergehen viel höhere Strafen bekommen als Spieler, bei denen kein Hinweis auf Migrationsgeschichte vorliegt. Das ist Alltag und läuft immer weiter, wenn aus den empirischen Beobachtungen keine Regulation entwickelt wird. Es ist eine Mammutaufgabe, das gut zu definieren, damit wir dem nachgehen können. Das kann man nicht den NGOs überlassen. Es ist auch eine staatliche Aufgabe. Zumindest muss der Staat der Gesellschaft die Möglichkeit geben, Ungleichwertigkeitsideologien und -strukturen zu beheben. Es hat über 50 Jahre gedauert, bis wir in der polizeilichen Kriminalstatistik eine Differenzierung haben nach antimuslimischen Taten und anderen. Die NGOs dokumentieren viele Übergriffe auf Geflüchtetenunterkünfte, die nicht aufgeklärt sind. All das gehört in den Topf der Bestandsaufnahme an Problemen.
Lena Kampf:
Bei der Aufklärung der Ceska-Mordserie gibt es einen Profiler aus Baden-Württemberg, der in einer Analyse von 2007 schreibt: „Vor dem Hintergrund, dass die Tötung eines Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist“ – da wird Gewalt als etwas konstruiert, das von außen zu uns kommt; Flüchtlinge, Silvester, Ehrenmorde, Terror. Haben Sie den Eindruck, dass Gewalt dann als besonders schlimm wahrgenommen wird, wenn sie von Menschen begangen wird, die als nichtdeutsch gelesen werden? Können Sie das erklären?
Andreas Zick:
Ja, absolut. Dass jemand gewaltorientierter, aggressiver sei, dass jemand zu Kriminalität neige, weil sie oder er einer bestimmten Gruppe angehört, das sind stereotype Zuschreibungen, die vorurteilsbasiert sind. Man schreibt einer Gruppe ein Merkmal zu, welches die Gruppe oder Personen, die ihr angehören, abwertet, entwürdigt, als minderwertig markiert. Dahinter steckt ein Motiv. Andere werden als gewalttätig beschrieben, um sie letztendlich auf Distanz zu halten. Die Unterstellung von Kriminalität oder Gewaltorientierung ist ein klassisches Abwertungsmuster. Entwürdigender noch ist eine Dehumanisierung. Andere werden gar nicht mehr als Menschen beschrieben, sondern als Strom, Welle, Tiere. Sie bringen Krankheiten und Seuchen.
Wir haben in unserer letzten Studie „Gespaltene Mitte“ gesehen, dass 40 Prozent glauben, durch Zuwanderung von Geflüchteten käme der Terror in das Land, was eine Wahrnehmungsverzerrung ist. Es übersieht, dass der Terror von außen gesteuert ist und Terroristen zwar Fluchtwege und Migration nutzen, aber nicht als Migranten. Sie inszenieren sich als Geflüchtete, um Anschläge zu verüben. Der Generalverdacht erzeugt mehr Konflikte und Probleme als Prävention. Daher müssen wir fragen: Welche Funktion hat diese Verzerrung und warum gerade jetzt? Vielleicht dienen die Zuschreibungen von Gefahr und Terror ja nur dazu, eine eigene nationale Identität zu entwickeln, die ‚uns‘ positiv erscheinen lässt? Dass die Bilder aggressiver geworden sind, mag eher daran liegen, dass sich Gruppen hier extrem abschotten wollen.
Lena Kampf:
Das zeugt doch auch von einem limitierten Terrorbegriff: Der Blick ist ausschließlich auf islamistischen Terror gerichtet.
Andreas Zick:
Die Art, wie Vorurteile den NSU-Prozess beeinflusst haben, ist ja hinreichend dokumentiert. Der Terrorbegriff ist rechtlich nicht limitiert, aber wenn man nur in eine Richtung schaut, dann limitiert man ihn. Das führt dann auch dazu, dass Deutsche, die vielleicht eine Migrationsgeschichte haben und sich hier radikalisieren, gar nicht mehr als die Unsrigen betrachtet werden. Ich und einige andere haben 2014 vermutet, dass sich rechtsextreme Terrorzellen bilden, aber das Phänomen haben die meisten eher dem islamistischen Terror vorbehalten. Und daran merkt man immer wieder, Wahrnehmungsverzerrungen sind wirkmächtig. Es geht um Klassifikation und Hierarchisierung, um die Herstellung von Hierarchien, immer um die Herstellung von Schubladen, in die andere hineingetan werden – während wir als die Deutschen in Anspruch nehmen, dass wir vielfältig sind, unterschiedlich, tolerant, dass man uns gar nicht über einen Kamm scheren kann. Das sind klassische psychologische Effekte mit dramatischen Folgen, wenn es um Aufklärung und Strafverfolgung geht.
Lena Kampf:
Gibt es so etwas wie kulturspezifische Gewalt? Kann man sexualisierte Gewalt auf dem Oktoberfest durch Deutsche mit den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht überhaupt vergleichen?
Andreas Zick:
Sexualisierte Gewalt ist Gewalt. Mit dem Blick auf Opfer und die Beschädigung ist ihre Sicht und Empfindung wesentlich. Mit dem Blick auf Ursachen können Unterschiede in kulturellen Normen und Wertvorstellungen helfen, die Gewalt besser zu verstehen, um eine angemessene Prävention und Intervention möglich zu machen. Die kulturvergleichende Forschung analysiert, wie Kulturen kulturelle Werte, Normen und Verhaltensmuster prägen. Sie kann helfen, zu klären, wie Gewalt entsteht, wie sie sich ritualisiert, welche stereotypen Bilder kulturspezifisch sind. In der Kölner Silvesternacht gab es Gruppen, die ein kulturell überformtes Stereotyp von Frauen haben, eine bestimmte kulturalisierte Verhaltensweise zeigen, die man auf dem Oktoberfest so nicht finden würde. Bevor nun aber von Gewaltkulturen die Rede ist, müssen auch Einflüsse des situativen Kontextes bedacht werden. Gewalt kann weniger auf kulturell eingeübte Muster, als vielmehr auf große Menschenmengen, mangelnde Zivilcourage, Partystimmung usw. zurückgeführt werden. Es gibt keine Kultur, die sagt: Reist nach Köln, um dort Frauen anzugreifen.
Wir müssen also vorsichtig sein. Wir suchen nach dem einfachen Effekt, wir suchen immer nach dem einen Faktor, vielleicht noch nach zwei oder drei Faktoren, weil wir vier Faktoren schon gar nicht mehr denken können. Dann ziehen wir das Vorurteil, wir ziehen die Schublade auf, stecken die Leute rein und schon haben wir eine Erklärung.
Lena Kampf:
Gewalt wird konstruiert als etwas, das von außen kommt, um vom eigenen Versagen abzulenken?
Andreas Zick:
Ja genau. Bei Fällen mangelnder Zivilcourage, die es in Köln auch gegeben hat, war das der Fall. Wir haben über die Kölner Domplatte schon vor Jahren geredet. Wenn man die Domplatte so baut, dass man quasi eine Arena hat auf den Haupteingang, dann kann das ein erleichternder Faktor für Gewalt sein. Zumindest kann man das prüfen. Kann sein, muss nicht sein. Wichtig ist gute Aufklärung. Das heißt, man muss hier Kontrollmechanismen einbauen und die Situation erforschen.
Lena Kampf:
Kontrollmechanismen, also schauen, was schreibt der Rechtsstaat vor, darauf prüfen wir jetzt den Einsatz …
Andreas Zick:
Nein, es geht auch um die Frage der Vermittlung. Es geht um die Frage des Verstehens. Nur die Rechtsregel hilft uns gar nichts. Das muss internalisiert werden und das muss nachvollzogen werden. Ich muss ja nicht nur lernen, dass ich mich strafbar mache, wenn ich Racial Profiling mache, sondern kompetent bin ich erst dann, wenn ich kapiere, dass Racial Profiling Rassismus ist. Natürlich braucht man Regeln, wenn da Straftaten begangen werden. Racial Profiling ist ein Vergehen in Deutschland. Das kann sanktioniert werden, aber die Regel allein erzeugt keine Handlung. Das wird uns nicht helfen. Selbst Rassisten wissen, was Rassismus ist; ziemlich gut sogar.
Lena Kampf:
Wie sehen Sie denn das Potenzial für Gewaltprävention? Welche Rolle kann da die Wissenschaft spielen?
Andreas Zick:
In England fährt man ein Konzept der öffentlichen Sicherheit mit tausenden Kameras, doch die Gewalt geht dennoch nicht zurück, wie Studien zeigen. Das zeigt, es braucht eine kluge Prävention im primären Bereich, also bevor Menschen selbst in die Situation hineinkommen, dass sie Gewalt ausüben. Prävention wie Intervention müssen klug sein und dazu braucht man Wissenschaft. Bei manchen Gewaltphänomenen hat man heute eine bessere Prävention, weil sie evidenzbasiert ist. Das trifft zum Beispiel auf den Bereich Schulamok zu. Das wurde gut untersucht und dann hat man dazu gelernt. Im Bereich der häuslichen Gewalt ist es besser geworden, nachdem die Gewaltzahlen öffentlich wurden. Aber wir haben viele Bereiche, in denen überhaupt nichts funktioniert. Es gibt gar nicht so viele, die forschen im Bereich der Gewaltprävention. Man denkt immer, angesichts der Gewalt und Konflikte gäbe es viel Forschung. Das trügt. Dazu kommt: Wir tauschen das Wissen so schlecht aus. Wenn eine Studentin eine kleine Studie durchführt im Rahmen einer Masterarbeit zu Gewaltprävention im Bereich häuslicher Gewalt, wo landet dann das Wissen aus der Studie?
Lena Kampf:
In der Bibliothek.
Andreas Zick:
... nicht mal in der Bibliothek. Die landet beim Gutachter. Nicht alles ist relevant, aber wir haben keine Instanz, die Wissen so sammelt, dass es für Praxis leicht zugänglich ist. Viel Wissen ist auch in den Behörden vorhanden, nur da kommen wir gar nicht dran, gerade im Bereich Rechtsextremismus. Wir haben die Potenziale und Gewinne überhaupt noch nicht verstanden. Der Zustand ist katastrophal, obwohl es sich gebessert hat.
Lena Kampf:
Sachsen ist immer wieder in die Schlagzeilen geraten, die Rede ist von einem „Failed Freistaat“. Sind Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Demokratieablehnung generell im Osten stärker und sind das sächsische Besonderheiten? Gilt das auch für Thüringen?
Andreas Zick:
Wir haben Daten vorliegen und die zeigen, dass wir ein überzufälliges Ost-West-Gefälle bei rechtsextremen Einstellungen haben. Wenn wir uns die Daten anschauen, dann sehen wir, dass es eine höhere Zustimmung zu offenen rechtsextremen Einstellungen gibt, die ganz unterschiedliche historische Hintergründe hat. In Sachsen gibt es weitverbreitete Meinungen – zum Beispiel, dass Menschen meinen, das Bundesland solle möglichst einheitlich, homogener sein und Unterschiedlichkeit oder Diversität sei ein Problem. Das ist höher ausgeprägt als in anderen Bundesländern. Also müssen wir mit Blick auf Sachsen genauer nach der Akzeptanz von Diversität fragen. Das mag daran liegen, dass man zu wenig Zugang zu Multikulturalität hatte. Zudem spielen autoritäre Politikvorstellungen eine große Rolle. Viele möchten einen starken Landesvater, man möchte starke Führer haben und damit verbunden ist die Hoffnung: Wenn man sich da unterordnet, dann sind die Probleme leichter zu lösen.
In Thüringen ist es noch mal ein bisschen anders, weil da auch die demografischen Unterschiede eine große Rolle spielen. Zum Beispiel haben wir in Sachsen ein Gefälle zwischen den urbanen Regionen und den ländlichen Regionen; das haben wir in Thüringen weniger. Wir haben in Thüringen auch stärkere Einflüsse der Abwanderung von bildungsstarken Gruppen auf die Zunahme von menschenfeindlichen Meinungen. Dagegen sind sich beide Länder ähnlich im Zusammenhang zwischen Ablehnung von Multikulturalität und menschenfeindlichen Einstellungen.
Lena Kampf:
Über die Einrichtung des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft wurde ja im Sommer 2016 gestritten. Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Thüringen Björn Höcke kritisiert das IDZ: „Ziel sei, konservative, patriotische und liberale Auffassungen zu diffamieren“, sagte Höcke, das sei ein Verstoß gegen die Thüringer Verfassung. Und der CDUler Mike Mohring: „Die Dokumentation von solchen extremistischen Problembereichen hat in einer privaten Organisation nichts verloren. Da ist der Verfassungsschutz für zuständig, den haben wir in Thüringen, und der müsste das machen. Der steht unter parlamentarischer Kontrolle.“ Was halten Sie von der Kritik?
Andreas Zick:
Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Kritik vor der Beschäftigung mit dem kommt, was man eigentlich tut. Das ist ein Zeichen dieser populistischen Verwerfung, die wir gerade haben. Das IDZ ist ins Leben gerufen worden, weil es Probleme gibt. Dass in dem Moment, wo es gegründet wird, die Probleme auch einmal sichtbar werden durch Angriffe, ist ja klar. Da muss man Geduld bewahren. Die Kritik impliziert, dass das Institut der verlängerte Arm einer politischen Position ist. Da würde ich mir anschauen: Wie kommt man darauf, was soll das eigentlich? Es soll in diese politische Ecke gestellt werden, um vor allem Fakten zu schaffen. Ich finde, die Angriffe waren zu erwarten, die werden auch nicht aufhören. Ich würde mich auf die Arbeit konzentrieren, ich würde versuchen, viele Menschen in die Arbeit mit aufzunehmen. Man muss sich eigentlich eher von außen darüber Gedanken machen, wie man den Leuten im Institut Hilfe anbieten kann, weil die Angegriffenen selbst aus sich selbst heraus nur schwer die Probleme lösen können.
Lena Kampf:
In welcher wissenschaftlichen Tradition sehen Sie das IDZ?
Andreas Zick:
Das kommt aus der Tradition in Jena und das verkörpert sich über das Team: ein klares Konzept zum Rechtsextremismus und qualitative wie quantitative Forschungsausrichtung. Was ich gut finde ist der multidisziplinäre Ansatz. Die Kollegen stammen nicht nur aus einer bestimmten Tradition, nicht nur aus den Rassismusdiskursen, nicht nur aus den Rechtsdiskursen, sondern aus verschiedenen Feldern. Klar ist auch, dass es in den historischen Linien eine Bürde mitnimmt, die aber ziemlich motivieren kann: Man kommt aus einem Versagen bei der Aufklärung von Rechtsextremismus und bei der Beobachtung; und man kommt mit der Schirmherrschaft der Amadeu Antonio Stiftung mit einem Erfahrungsschatz, über die Schwierigkeit durch Projektarbeit gesellschaftliche Zustände zu verändern. Diese beiden Linien finde ich interessant.
Lena Kampf:
Inwieweit kann denn das IDZ auch so eine Art Frühwarnsystem entwickeln?
Andreas Zick:
Ich würde das dem Institut sehr raten und auch raten, das mit anderen Instituten zu tun. Ich halte Prävention für extrem wichtig. Wir müssen Leute instand setzen, Ungleichwertigkeit im Vorfeld zu erkennen und zu bremsen – und nicht erst dann, wenn sie entstanden ist. Wenn man bestimmte Kompetenzen nicht hat im Bereich von Prävention, dann muss man mit anderen zusammen operieren; ein Frühwarnsystem, länderspezifisch, angepasst an die Tradition, die Geschichte und die Identitäten der unterschiedlichen Regionen, das wäre es ja.
Lena Kampf:
Was sind denn die Grenzen von Sozialforschung als Demokratisierungsprojekt?
Andreas Zick:
Ich würde raten, die Grenzen selbst zu bestimmen. Was möchte man eigentlich? Man kann die Auffassung haben, dass Forschung selbst zum gesellschaftlichen Wandel führen soll, so wie es die kritische Frankfurter Schule vorgeschlagen hat. Wenn man Forschung betreibt, muss man schauen, wie man die Grenze zu den Institutionen hinbekommt. Das heißt, man braucht beispielsweise einen sicherheitskritischen Diskurs. Da muss man abstecken, inwieweit man zusammenarbeitet mit Behörden.
Die andere Grenze würde ich ziehen zu einem grundlagenwissenschaftlichen Institut, was sehr universitär geprägt ist; wenn das IDZ das jetzt auch noch machen würde, wäre das eine Überforderung. Eher sollte man nach demokratischen Grundwerten und Kompetenzen schauen: Wo gibt es Beschädigungen, wo gibt es Angriffe von Menschen auch auf demokratische Grundregeln? Dieses mit einem wissenschaftlich genauen Blick richtig analysieren und Wissen bereitstellen zur Stärkung von Demokratie – dann finde ich, sind für mich die Grenzen zu anderen Instituten mit ihren Aufgaben relativ gut gesteckt. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man sich als Institut darüber Gedanken machen sollte, wie man klassische Grenzen überwinden kann – also wie kann man die Grenzen überwinden zwischen Politik, die man ja berät durch Bereitstellung von Wissen, und den NGOs, die zäh sind. Wenn man diese Brücken über das IDZ bauen kann, dann ist man gut aufgestellt für die Demokratiestärkung.