Soziale Bewegungen und Proteste gehören in vielen westlichen Ländern zur politischen Normalität. Und das sogar so weit, dass schon vor über zwei Jahrzehnten von einer „Bewegungsgesellschaft“ die Rede war (Neidhardt/Rucht 1993). Im Sinne einer engagierten und partizipativen Öffentlichkeit wurden Protestbewegungen meist als ein Korrektiv zu institutionalisierten politischen Akteuren und damit als eine bereichernde Stimme in demokratischen Aushandlungsprozessen verstanden.
Dieses progressiv-demokratische Verständnis (vgl. Honneth 1994) erfuhr in den letzten Jahren jedoch eine deutliche Verunsicherung (vgl. Roth/Rucht 2008: 10, vgl. auch zu Thüringen Bischof/Quent 2017). Nicht erst seit der PEGIDA-Bewegung besteht der Eindruck, dass sich einige der Bewegungen gegen eine plurale, demokratische Gesellschaft und die mit ihr verbundenen Institutionen richten. Schon einige Jahre vor den ersten PEGIDA-„Spaziergängen“ war anlässlich der Debatte um Thilo Sarrazin und der Stuttgart-21-Proteste bereits vom „Wutbürger“ die Rede (Kurbjuweit 2010). Unabhängig davon, wie treffend der Ausdruck letztlich die unterschiedlichen Gruppierungen beschreibt, macht er doch zweierlei deutlich: Offenbar erklang nach der Finanz- und Eurokrise die Stimme des Protests nicht mehr allein aus aktivistischen Milieus; zunehmend war sie auch aus der bürgerlichen Mitte zu vernehmen. Was sie zu sagen hatte, schien nicht immer von der Idee eines gerechteren oder freieren Zusammenlebens getragen zu sein, sondern oft von ressentimentgeladener Empörung. Einige Jahre später hat sich mit der AfD jene Empörung nun auch in den deutschen Parlamenten konsolidiert und ist zu einem festen Bestandteil des politischen Diskurses geworden.
Passend dazu ist in jüngerer Zeit ein deutlicher Vertrauensverlust in demokratische Institutionen beobachtbar (vgl. Embacher 2009). Ein immer größerer Teil der Bevölkerung fühlt sich politisch nicht mehr repräsentiert. Die Krise der repräsentativen Demokratie wurde auch im politik- und sozialwissenschaftlichen Diskurs registriert. Begriffe wie „Postdemokratie“ (Crouch 2008) oder „simulative Demokratie“ (Blühdorn 2013) bezeichnen dabei ähnliche Probleme: die neoliberale Auflösung eines nationalstaatlich gerahmten Wohlfahrtsprinzips, verbunden mit der Übertragung ebenfalls lange Zeit nationalstaatlich gefasster Entscheidungskompetenzen an supranationale Institutionen wie die EU oder an demokratisch nicht legitimierte Gremien, ThinkTanks und administrative Exekutivorgane.
Das problematisches Demokratieverständnis der „Empörungsbewegungen“
Die neuerliche Demokratiekritik vieler Protestbewegungen nimmt ihren Ausgangspunkt damit an tatsächlichen Problemlagen. Sie offenbart aber mitunter fragwürdige Demokratievorstellungen. Es wurde daher vorgeschlagen, von „postdemokratischen Empörungsbewegungen“ zu sprechen, da die Demokratiekritik eine Reaktion auf eine zunehmende Entleerung demokratischer Verfahren darstelle, aber selbst von einer lediglich diffusen Idee von Demokratie getragen sei (vgl. Ullrich 2015). Feindbildorientierte und repressive Demokratieforderungen sind vor allem von PEGIDA-Veranstaltungen oder der bewegungsnahen AfD zu vernehmen. Sie fanden sich aber auch bei den heterogeneren „Montagsmahnwachen für den Frieden“. Selbst die Occupy-Bewegung gab mit dem Slogan „We are the 99 percent“ eine simplifizierende Diagnose aus, die komplexe strukturelle Probleme auf die Machenschaften einer Elite reduziert und über diese Feindbildkonstruktion anschlussfähig für Ressentiments ist. Zwar findet die Idee der Demokratie als Staatsform noch immer in weiten Bevölkerungsschichten Zustimmung (vgl. Statistisches Bundesamt 2016). Aber ob diese Zustimmung als ein Resilienzfaktor gegen antidemokratische Politik verstanden werden kann, ist besonders vor dem Hintergrund des Einzugs der AfD in den Bundestag fraglich. Die verbreitete Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie lässt sich offenbar leicht für eine antidemokratische Politik mobilisieren.
Wenn mehr Demokratie gefordert oder die undemokratische Politik korrupter Machteliten kritisiert wird, muss daher gefragt werden, welches Demokratieverständnis dieser Kritik zugrunde liegt. Vorstellungen eines politischen Gemeinwesens, in denen die universelle Gleichwertigkeit der Menschen oder das Konzept einer selbstgewählten Lebensführung keine Rolle mehr spielen, widersprechen modernen, aufklärerischen Demokratieideen. Das gilt etwa für völkische oder ethnopluralistische Gemeinschaftsvorstellungen, die die Gleichwertigkeit der Menschen direkt infrage stellen. Ebenfalls trifft es auf eine feindbildorientierte und pauschale Elitenkritik zu, da sie lediglich einen Sündenbock präsentiert und damit an unterschwellige Ressentiments und Vorurteilsstrukturen anknüpft. Das Problem ist jedoch nicht nur eines ‚in den Köpfen‘, es hängt ebenso mit der politischen Praxis und politischen Kultur zusammen. Der Verbindung von Demokratieverständnis, politischer Kultur und Partizipation möchte ich im Weiteren nachgehen und eine Erklärung anbieten, weswegen der Vertrauensverlust in demokratische Institutionen in jüngerer Zeit zugleich problematische Demokratievorstellungen offenbarte.
Wer Demokratie sagt, meint Beteiligung
In modernen Demokratietheorien ist die Frage nach demokratischer Legitimation eng mit Möglichkeiten politischer Partizipation verbunden. Politische Entscheidungen können nach diesem Verständnis nur dann als demokratisch legitimiert – das heißt als im Interesse aller – gelten, wenn sie Ergebnis eines Aushandlungsprozesses sind und sich öffentlich rechtfertigen lassen. „Wer Demokratie sagt“, so kann der Punkt zusammengefasst werden, „meint Partizipation“ (van Deth 2009: 141). Das setzt aber eine politische Öffentlichkeit voraus, an der möglichst viele Menschen gleichberechtigt und vor allem aktiv teilnehmen. Je lebendiger und vielfältiger die Beteiligung an der politischen Willensfindung ist, desto mehr Legitimität kann der so gebildete Gemeinwille für sich beanspruchen. Denn dadurch kann ausgeschlossen werden, dass Politik nur für bestimmte Interessengruppen gemacht wird. Die Idee einer breiten, demokratischen Zivilgesellschaft beinhaltet damit schon von sich aus egalitäre und liberale Wertvorstellungen.
Gerade an den ungleichen Beteiligungsmöglichkeiten entzündet sich die jüngere Kritik an postdemokratischen Verhältnissen. Diese beklagt den übermäßigen und demokratieschädlichen Einfluss von Wirtschaftsorganisationen auf politische Entscheidungen und bezweifelt daher, dass eine neoliberale Politik demokratisch legitimiert ist. Die Klage über nachlassendes Vertrauen in demokratische Institutionen ist aber nicht neu. Sie spielte schon in den 1960er und 1970er Jahren eine gewisse Rolle im sozial- und politikwissenschaftlichen Diskurs – vor allem assoziiert mit Jürgen Habermas und Claus Offe. An dieser Stelle lohnt sich daher ein Rückblick auf ältere Theorien, die einen Legitimationsverlust in demokratischen Gesellschaften diagnostizierten – auch wenn die damalige Situation in einigen Punkten von der heutigen abweicht.
Zum Beispiel genoss die deutsche Sozialdemokratie in den Jahren, in denen Habermas „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“ (Habermas 1973) diagnostizierte, trotz der 68er-Proteste eine Akzeptanz und Zustimmung, die aktuell ihresgleichen suchen. Ökonomische Krisen schienen beherrschbar geworden zu sein, die Wirtschaft wuchs weitgehend stabil und führte dadurch zum sozialen Aufstieg breiter Bevölkerungsschichten: dem „Fahrstuhleffekt“ (Beck 1986).
So gesehen waren die 1960er und frühen 1970er Jahre eine Zeit großer sozialer und politischer Integration, was sich auch daran zeigte, dass CDU, CSU und SPD auf eine außerordentliche Mehrheit der Stimmen zählen konnten. Dass Habermas trotzdem von Legitimationsproblemen sprach, verwundert daher zunächst; es kann aber helfen, die Ambivalenz im Demokratieverständnis neuerer Protesterscheinungen besser zu verstehen.
Mangelnde Beteiligung im Nachkriegsdeutschland – eine Spurensuche
Habermas bezeichnete mit Legitimationsverlust nicht den Verlust an Zustimmung zu Parteien und Politik, sondern – ganz im Sinne des geschilderten Demokratieverständnisses – meinte er einen Verlust an politischer Beteiligung. Nach der normativen Demokratietheorie, die Habermas im Hinterkopf hatte, gelten politische Entscheidungen nur dann als demokratisch legitimiert, wenn sie im Verfahren eines öffentlichen Aushandlungsprozesses getroffen worden sind oder im Zweifelsfall dadurch nachträglich gerechtfertigt werden können (vgl. Habermas 1973: 144; Habermas 1990; Habermas 1998). Nach der Theorie von Almond und Verba (1965) ließe sich auch sagen, dass demokratische Legitimation nur im Rahmen einer participant political culture hergestellt werden kann. Damit ist eine politische Kultur gemeint, in der die Staatsbürger_innen nicht nur Empfänger_innen staatlicher und politischer Leistungen – eines Outputs – sind, sondern zugleich auch über Beteiligung an politischen Aushandlungsprozessen, Initiativen, sozialen Bewegungen oder ähnlichem einen relevanten Input in das politische System leisten.
An dieser Stelle hakte die kritische Diagnose von Habermas ein. Zwar schaffte es der bundesrepublikanische Sozialstaat der Nachkriegszeit durch eine interventionistische Politik wirtschaftliche Krisentendenzen zu entschärfen und Arbeitskämpfe beziehungsweise Klassenkonflikte weitgehend zu befrieden. Aber das gelang, so bilanzierte Habermas, nur um den Preis einer „Reinigung der politischen Teilhabe von partizipatorischen Gehalten“ (Habermas 1995: 514). Gemeint ist damit, dass die politische Integration in den Sozialstaaten vorwiegend über die Teilhabe an staatlichen und politischen Leistungen erzielt wurde. Mit anderen Worten: Der Input in das politische System – zivilgesellschaftliches und politisches Engagement – verlor gegenüber dem Output an Bedeutung.
Zum Output des Sozialstaates gehören etwa die unterschiedlichen Leistungen der Sozialversicherung, der Arbeitnehmer_innenschutz, die Ermöglichung von Aufstiegschancen und die Absicherung von Erwerbsbiografien (vgl. Habermas 1995: 510f). Aber der Output beschränkt sich nicht nur auf materielle Leistungen. Darunter fiel auch ein soziales Identitätsangebot, das auf die Berufsrolle und auf ein sozialstaatlich abgefedertes Normalarbeitsverhältnis konzentriert war.
Die damit assoziierten Werte wie Wohlstand und Leistungsbereitschaft drückten der sozialen Integration und den Wertvorstellungen der sogenannten „Mitte“ ihren Stempel auf und bildeten nach 1945 auch die Grundlage einer erneuerten nationalen Identität (vgl. Decker et al. 2014).
Habermas vermutet nun, dass ein Teil des sozialstaatlichen Outputs die Aufgabe erfüllt, für die mangelnden Mitbestimmungsmöglichkeiten „in einer strukturell entpolitisierten Öffentlichkeit“ zu entschädigen (Habermas 1973: 55). Selbst im Kernbereich der sozialstaatlichen Politik finden sich daher nur Ansätze einer partizipatorischen politischen Kultur, da Arbeits- und Tarifkonflikte routiniert von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften stellvertretend für die Lohnarbeitenden gemanagt werden. Die Rolle, die den Staatsbürger_innen in diesem politischen System zukommt, ist nicht die eines engagierten Citoyens, sondern die von Klient_innen: „Klienten, das sind die Abnehmer, die in den Genuß des Sozialstaates kommen; und die Klientenrolle ist das Pendant, das eine zur Abstraktion verflüchtigte, ihrer Effektivität beraubte politische Teilnahme akzeptabel macht“ (Habermas 1995: 515). Nach der zugespitzten Diagnose von Habermas lässt sich daher für die alte Bundesrepublik eher von einer autoritär strukturierten subject political culture sprechen (Almond/Verba 1965), da die Bürger_innen periodisch im Wahlgang den jeweiligen Funktionseliten ihr Einverständnis geben oder verweigern können, darüber hinaus aber weitgehend passiv bleiben (vgl. Habermas 1973: 106ff.). Das gleiche lässt sich in extremerer Form auch für die DDR sagen. In dieser politischen Kultur werde Teilhabe nicht über Beteiligung an Aushandlung eines Gemeinwillens verstanden, sondern über politische Repräsentation und Empfang politischer Leistungen bestimmt. Sofern dies gelingt, können die politischen Institutionen zwar mit einem hohen Maß an „Massenloyalität“ (Habermas 1995: 509), also Zustimmung, rechnen. Diese Zustimmung ist aber nicht mit demokratischer Legitimation gleichzusetzen.
Die Institutionalisierung sozialer Rechte im Sozialstaat wird gemeinhin als ein Schritt in der Verwirklichung universeller und gleicher gesellschaftlicher Teilhabe gelesen (vgl. Honneth 1994). Denn Partizipation erfordert ein Mindestmaß an Zeit, Bildung und materieller Grundsicherung. Aber die sozialstaatliche Regierungsweise begünstigt für Habermas bei den Bürger_innen eine politische Haltung, die wenig Wert auf Partizipation legt. Und damit nehmen die mit gleicher Beteiligung assoziierten universalistischen Werte in der politischen Praxis ebenfalls einen geringeren Stellenwert ein. Im Gegenteil: Die Reduktion politischer Teilhabe auf den Empfang von staatlichen Entschädigungsleistungen führt zu einem Denken, in dem die gruppenbezogene Anspruchsberechtigung auf jene Leistungen im Vordergrund steht.
Schließlich scheint es das sozialstaatliche Arrangement notwendig zu machen, sowohl den Umfang des Outputs als auch die Gruppe, die legitimen Anspruch auf diesen hat, zu begrenzen. Üblicherweise sind das deutsche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Normalarbeitsverhältnissen. Dieses „kommunitaristische“ Prinzip, das Teilhabe über Gruppenzugehörigkeit bestimmt, läuft dem „kosmopolitischen“ Egalitätsprinzip demokratischer Partizipation zuwider, das Teilhabe an universalistischen Gesichtspunkten festmacht (vgl. Merkel 2017). Aussagen wie „Wir sind nicht das Weltsozialamt“, die so ähnlich von NPD, AfD aber auch CSU in Wahlkämpfen getätigt wurden, drücken dieses Spannungsverhältnis zugespitzt aus: Die gruppenbezogene Anspruchshaltung
wird damit gegen universelle Schutz- und Teilhaberechte ausgespielt.
Eine Folge: problematische Demokratieverständnisse
Aus heutiger Sicht fallen an der Diagnose von Habermas zwei Schwachpunkte ins Auge: Zum einen konnte Habermas den Rückbau des Sozialstaates und das Aufkommen neoliberaler Wirtschaftspolitik nicht vorhersehen, die ab den 1980er Jahren an Fahrt aufnahmen (vgl. Nachtwey 2010). Zum anderen unterschätzte Habermas die Bedeutung der neuen sozialen Bewegungen, die ab den 1970er Jahren die politische Landschaft in Deutschland mitprägten. Durch die „Beteiligungsrevolution“ (Kaase 1984) erweiterte sich nicht nur das Repertoire politischer Partizipation. Mit den Grünen etablierte sich auch eine Partei, die einen dezidierten Bewegungshintergrund hatte. Das schränkt die Argumentation von Habermas ein, entkräftet sie aber nicht auf ganzer Linie.
Denn die These von der Beteiligungsrevolution blendet aus, dass die politische Partizipationskultur vorwiegend von aktivistischen und gebildeten Milieus getragen ist – sie setzte sich also nur in Teilen der Gesellschaft durch (vgl. Böhnke 2011). Ebenso führt der Rückzug des Sozialstaates nicht ohne weiteres zu einem Wandel der politischen Kultur. Eher ist zu erwarten, dass sich das Spannungsverhältnis zwischen sozialstaatlicher Identitätspolitik und einem demokratischen Universalismus in Krisenzeiten verschärft. An diesem Punkt lässt sich zum Ausgangsproblem zurückkehren. Wenn also tatsächlich die partizipatorische Revolution nur auf bestimmte, aktivistische Milieus beschränkt bleibt, so lässt sich vermuten, dass die ambivalente Demokratiekritik der „postdemokratischen Empörungsbewegungen“ u. a. daher rührt, dass an ihnen Menschen teilnehmen, deren Demokratieverständnis vorwiegend durch die beschriebene Output-Kultur geprägt ist. Wenn die These zutrifft, dann verlieren demokratische Institutionen an Vertrauen, weil sie infolge des Bedeutungsverlusts sozialstaatlicher Politik nicht mehr ausreichend ‚leisten‘. Beklagt wird damit ein mangelnder Output öffentlicher und staatlicher Institutionen, aber nicht mangelnde Mitbestimmung. Ein Indiz dafür ist etwa, dass Veranstaltungen jenes Typs tatsächlich vermehrt von Protestneulingen besucht werden, die zwar politisch interessiert, sonst aber weniger politisch aktiv sind. Das lässt sich sowohl bei den Montagsmahnwachen für den Frieden (vgl. Daphi et al. 2014) als auch für PEGIDA (vgl. Rucht et al. 2015) und selbst für die deutsche Occupy-Bewegung (vgl. Brinkmann et al. 2013) feststellen.
Hinweise auf das geschilderte Demokratieverständnis finden sich auch in zwei Kerngedanken, die in der Kritik und den politischen Forderungen immer wieder auftauchen: zum einen die Behauptung einer privilegierten Anspruchsberechtigung auf die Vertretung und Zuwendung der öffentlichen Politik oder der Medien; zum anderen eine pauschale Elitenkritik, die sich um eine Vernachlässigung oder einen Verrat der Bevölkerung seitens der Eliten dreht.
Zwei Grundmotive antidemokratischer Kritik: Zugehörigkeitspolitik und pauschale Elitenkritik
Die Betonung eines privilegierten Anspruchs auf staatlich garantierte Rechte und Leistungen lässt sich am deutlichsten bei rechten Bewegungen finden. Die PEGIDA-Parole „Wir sind das Volk“
appelliert unmissverständlich an die Politik, die Interessen der Protestierenden – ihre ‚Sorgen und Nöte‘ – in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen. Hier geht es nicht darum, durch Beteiligung an politischen Aushandlungsprozessen an der Bildung eines politischen Gemeinwillens teilzuhaben. Die PEGIDA-Anhänger_innen behaupten schließlich, bereits den – primär ethnisch bestimmten – ‚Volkswillen‘ zu repräsentieren. Hier geht es stattdessen ganz im Sinne einer Output-orientierten politischen Kultur darum, dass die Politik liefert, was das Volk bestellt.
Die Forderungen haben damit einen deutlich autoritären Zug, da nicht politische Elitenbildung und ungleiche Partizipationsmöglichkeiten im Zentrum der Kritik stehen, sondern lediglich die Vernachlässigung seitens ebenjener Eliten. Diese autoritäre Struktur macht sich ebenfalls in
der konkurrenzbetonten Abwertung anderer Gruppen bemerkbar. Bei PEGIDA dreht sie sich vorwiegend um einen ethnisch verstandenen Islam sowie um Geflüchtete. In anderen Diskursen
richtet sich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eher gegen Menschen, die als (leistungs-)schwach wahrgenommen werden, aber denen es vermeintlich dennoch zu gut gehe
(vgl. Heitmeyer 2012). Damit geht meist das subjektive Gefühl einher, benachteiligt zu werden, obwohl die objektive soziale Lage der Empörten meistens nicht schlecht ist (vgl. Hilmer et al. 2017).
Das zweite Motiv, eine pauschale Elitenkritik und Feindbildkultur, ist gewissermaßen das Spiegelbild des Anspruchsdenkens und zeichnet sich durch eine undifferenzierte Ablehnung öffentlicher und politischer Akteure aus – seien es Parteien, Politiker, Gewerkschaften oder Presse. Zentral ist hier der Gedanke, dass effektive demokratische Teilhabe durch die Machenschaften einer korrupten Elite systematisch verhindert wird. Anhänger_innen dieses tendenziell verschwörungsideologischen Weltbilds neigen jedoch dazu, durchaus bestehende Gestaltungs- und Partizipationsmöglichkeiten schlicht zu ignorieren (vgl. Klein 2014). Auch wenn Verschwörungsdenken als ein Ausdruck politischer Ohnmachtsgefühle verstanden werden kann, führt die damit einhergehende Geringschätzung gegenüber verfügbaren Beteiligungsmöglichkeiten zu einer Verstärkung jener Ohnmachtsempfindungen. Die Feindbildorientierung knüpft außerdem an Ressentiments und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an. Solche Denkmuster sind nicht nur in rechten Bewegungen verbreitet, sondern sie finden auch Anhänger in Milieus, die sich als eher ‚links‘ verstehen – wie etwa die Mahnwachen für den Frieden – und dürften auch in der sogenannten Mitte weit verbreitet sein. Vereinzelt ist daher schon von einer neuen, breitenwirksamen Querfront die Rede, die sich um eine antiamerikanische und antisemitische Elitenkritik entspinnt und dabei traditionell eher linke, antiimperialistische Denkfiguren mit antidemokratischen und schlicht rechtsextremen Motiven verknüpft (vgl. Storz 2015).
Mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung – eine Herausforderung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die einseitige politische Kultur der BRD dazu beiträgt, genau die Einstellungen zu untergraben, auf die ein demokratisches Gemeinwesen angewiesen ist. Sowohl die gruppenbezogene Anspruchshaltung als auch die pauschale Elitenkritik zeichnet ein eher passives Verhältnis zu öffentlichen Aushandlungsprozessen aus. Schon in der Populismus-Debatte der frühen 2000er wurde festgestellt, dass die Anhängerschaft populistischer Parteien kein Interesse an mehr Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten hat. Stattdessen herrschte die Erwartung vor, dass charismatische Führungspersönlichkeiten gleichsam intuitiv den vermeintlichen Volkswillen erfassen und in die Tat umsetzen (vgl. Mudde 2004). Diese knappen Bemerkungen sollen illustrieren, dass die Demokratiekritik neuerer „Empörungsbewegungen“ wie auch sogenannter populistischer Politik auf ein Demokratieverständnis verweisen, das soziale und politische Teilhabe über den Empfang staatlicher Leistung – eines Outputs – bestimmt. Dieses Verständnis steht, so wurde mit Habermas zu zeigen versucht, in einer gewissen Tradition mit einer politischen Kultur, die durch sozialstaatliche Repräsentationspolitik geprägt ist. Nicht die gleichberechtigte Partizipation an politischen Aushandlungsprozessen, sondern die Repräsentation durch eine politische Führung und die Teilhabe an einem staatlichen Output stehen dabei im Mittelpunkt des Demokratieverständnisses.
Egalitäre Demokratien sind zu ihrer Erhaltung folglich auf eine partizipative politische Kultur angewiesen. Aber es ist fraglich, ob ‚besorgte Bürger‘ ohne weiteres für eine partizipatorische Praxis zu motivieren sind. Ihr Protest versteht sich schließlich als eine Ausnahmehandlung, als empörter Widerstand gegen eine korrupte Elite – und nicht als eine übliche Form zivilgesellschaftlicher Beteiligung. Die Forderungen, sich wieder vermehrt um die Nöte der Besorgten zu kümmern, bleiben daher einem Demokratieverständnis treu, das auf einen gruppenbezogenen Output setzt. Das trifft auch auf die Sammlungsbewegung zu, die zuletzt von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine lanciert wurde. Vorschläge wie diese stellen keine Lösung des Problems dar und helfen, Ideologien der Ungleichwertigkeit und Ressentiments als politische Optionen zu etablieren. Zwar hat gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit andere Ursachen, aber sie verträgt sich gut mit einem passiven, klientelistischen Demokratieverständnis. Dagegen gibt es in einer vitalen, partizipatorischen politischen Kultur weniger Nischen für die Abwertung von Menschengruppen (vgl. Quent/Schulz 2015; Klein 2017). Die Herausforderung besteht somit darin, gegen die Trägheit der bestehenden politischen Kultur und den allgegenwärtigen Rechtsruck eine lebendige, demokratisch-zivilgesellschaftliche Perspektive zu entwerfen, in der Teilhabe nicht mehr allein von ‚denen da oben‘ eingeklagt, sondern unter egalitären und inklusiven Gesichtspunkten selbst gestaltet wird.
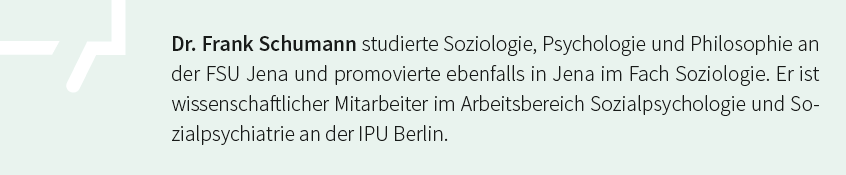
Literatur
Almond, A. Gabriel/Verba, Sidney (1965): The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Little, Brown and Company: Boston, Toronto.
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Bischof, Susann/Quent, Matthias (2017): Was bewegt die Zivilgesellschaft? Protestereignisanalyse als Indikator für soziale Konfliktpotenziale. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft [Hrsg.]: Wissen schafft Demokratie, 2017/01. Online: www.idz-jena.de/wsddet/was-bewegt-die-zivilgesellschaft-protestereignisanalyse-als-indikator-fuer-soziale-konfliktpotenzia/ [20.10.2017].
Blühdorn, Ingolfur (2013): Simulative Demokratie. Neue Politik nach der postdemokratischen Wende. Suhrkamp: Berlin.
Böhnke, Petra (2011): Ungleiche Verteilung politischer und zivilgesellschaftlicher Partizipation. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 61, Heft 1-2, S. 18 – 25.
Brinkmann, Ulrich/Nachtwey, Oliver/Décieux, Fabienne (2013): Wer sind die 99%? Eine empirische Untersuchung der Occupy-Proteste. OBS-Arbeitspapier 6. Online: www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/Arbeitspapier_06_Occupy.pdf [27.09.2017].
Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Daphi, Priska/Rucht, Dieter/Stuppert, Wolfgang/Teune, Simon/Ullrich, Peter (2014): Occupy Frieden. Eine Befragung von Teilnehmer/innen der "Mohntagsmahnwachen für den Frieden". Online: depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/5260/3/occupy-frieden.pdf [27.09.2017].
Decker, Oliver/Kiess, Johannes/Rothe, Katharina/Weißmann, Marliese/Brähler, Elmar (2014): Wohlstand, autoritäre Dynamik und narzisstische Plombe. Psychoanalytisch-sozialpsychologische Beiträge zur Kritik der postdemokratischen Gesellschaft. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 27, Heft 1.
Embacher, Serge (2009): Demokratie! Nein danke? Demokratieverdruss in Deutschland. Dietz: Berlin.
Habermas, Jürgen (1990): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Habermas, Jürgen (1973): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Habermas, Jürgen (1995): Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Habermas, Jürgen (1998): Faktizität und Geltung. Beitrag zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Heitmeyer, Wilhelm (2012): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einem entsicherten Jahrzehnt. In: Wilhelm Heitmeyer [Hrsg.]: Deutsche Zustände. Folge 10. Suhrkamp: Berlin, S. 15–41.
Hilmer, Richard/Kohlrausch, Bettina/Müller-Hilmer, Rita/Gagné, Jérémie (2017): Einstellung und soziale Lebenslage. Eine Spurensuche nach Gründen für rechtspopulistische Orientierung, auch unter Gewerkschaftsmitgliedern. Online: www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_044_2017.pdf [06.09.2017].
Honneth, Axel (1994): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Kaase, Max (1984): The Challenge of the "Participatory Revolution" in Pluralist Democracies. In: International Political Science Review, 5, Heft 3, S. 299 – 318.
Klein, Anne (2014): Mitten in einer entleerten Demokratie? In: Klein, Anne/Zick, Andreas [Hrsg.]: Fragile Mitte - Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014. Dietz: Bonn, S. 85 – 101.
Klein, Ansgar (2017): Engagement- und Demokratiepolitik vor der rechtspopulistischen Herausforderung. Die Stärkung von Orten demokratischen Lernens als Aufgabe zivilgesellschaftlicher Struktur- und Gesellschaftspolitik. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 30, Heft 2, S. 108 – 119.
Kurbjuweit, Dirk (2010): Der Wutbürger. Online: www.spiegel.de/spiegel/print/d-74184564.html [26.09.2017].
Merkel, Wolfgang (2017): Kosmopolitismus versus Kommunitarismus. Ein neuer Konflikt in der Demokratie. In: Philipp Harfst/Thomas Poguntke/Ina Kubbe [Hrsg.]: Parties, Governments and Elites. The Comparative Study of Democracy. Springer VS: Wiesbaden, S. 9 – 24.
Mudde, Cas (2004): The Populist Zeitgeist. In: Government & Opposition, 39, Heft 3, S. 541–563.
Nachtwey, Oliver (2010): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus revisited. In: Becker, Karina/Gertenbach, Lars/Laux, Henning/Reitz, Tilman [Hrsg.]: Grenzverschiebungen des Kapitalismus. Umkämpfte Räume und Orte des Widerstands. Campus: Frankfurt a. M./New York, S. 359 – 379.
Neidhart, Friedhelm/Rucht, Dieter (1993): Auf dem Weg in die "Bewegungsgesellschaft"? Über die Stabilisierbarkeit sozialer Bewegungen. In: Soziale Welt, 44, Heft 3, S. 305 – 326.
Quent, Matthias/Schulz, Peter (2015): Rechtsextremismus in lokalen Kontexten. Vier vergleichende Fallstudien. Springer VS: Wiesbaden.
Roth, Roland/Rucht, Dieter (2008): Einleitung. In: Roth, Roland/Rucht, Dieter [Hrsg.]: Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch. Campus: Frankfurt a. M./New York, S. 9 –36.
Statistisches Bundesamt [Hrsg.] (2016): Datenreport 2016. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Online: www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016.pdf [19.10.2017].
Storz, Wolfgang (2015): "Querfront". Karriere eines politisch-publizistischen Netzwerks. Online: www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/AP18_Storz_2015_10_19.pdf [26.09.2017].
van Deth, Jan (2009): Politische Partizipation. In: Kaina, Viktoria/Römmele, Andrea [Hrsg.]: Politische Soziologie. Ein Studienbuch. Springer VS: Wiesbaden, S. 141–162.


