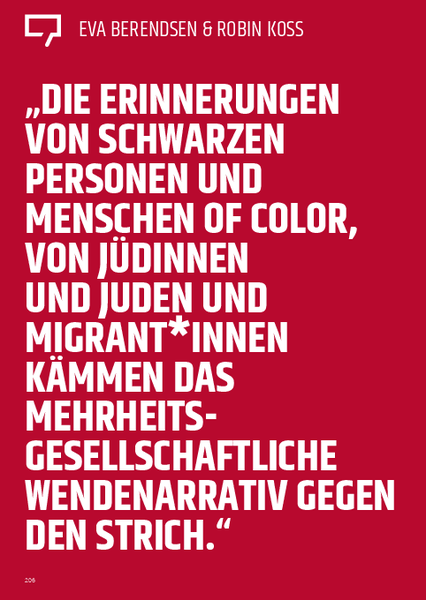Bevor wir auf den Straßen getanzt und ,Wahnsinn‘ gebrüllt haben,
waren wir eingehüllt in unsere Ängste.
(Joachim Gauck 2014)
das wieder vereinigte deutschland
feiert sich wieder 1990
ohne immigrantInnen flüchtlinge jüdische
und schwarze menschen
es feiert im intimen kreis
es feiert in weiß
doch es ist ein blues in schwarz-weiß
(May Ayim 1990)
Auch 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist das Bild, das wir uns von diesem zentralen Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte machen, noch unvollständig. Es sind Szenen jubelnder Menschen am Brandenburger Tor, die das offizielle Erinnern an den November 1989 prägen. Noch im Jubiläumsjahr 2019 beherrschten vornehmlich Geschichten über die „friedliche Revolution“ und das Streben nach Freiheit und freier Marktwirtschaft die Berichterstattung, wobei dieses gängige, allzu glatte Wende-Narrativ im großen Erinnerungsdiskurs durchaus durchkreuzt wurde: Etwa wurde Akteur*innen der DDR-Opposition verstärkt Gehör geschenkt, die daran erinnerten, dass das politische Ziel der Bewegung nach einem demokratischen Aufbruch mitnichten zwangsläufig an die Vereinigung mit der kapitalistischen BRD gekoppelt war (Gürgen 2019). In den sozialen Netzwerken wurde unter dem Hashtag #baseballschlägerjahre an das Erstarken der ostdeutschen Neonaziszene quasi als Konsequenz der Wende erinnert; vornehmlich Linke teilten ihre oft sehr persönlichen Erfahrungen mit neonazistischer Gewalt und antifaschistischem Widerstand in den neunziger Jahren (Bangel 2019). Nur sehr randständig wurden und werden die Erfahrungen und Erinnerungen jener Personengruppen thematisiert, die nicht der weißen Dominanzgesellschaft angehören.
Die Schwarze1 Lyrikerin und Aktivistin May Ayim schrieb im Jahr 1993 (2012 [1993]): 54): „Als die Mauer fiel, freuten sich viele, anderen wurde es schwindelig.“ Diese Zeilen Ayims wurden titelgebend für die Wende-Ausstellung, welche die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main konzipierte und von November 2019 bis Mai 2020 in ihren Räumen zeigte: „Anderen wurde es schwindelig. 1989/90: Schwarz, jüdisch, migrantisch“. Sie versammelt künstlerisch-dokumentarische Positionen dreier ganz unterschiedlicher Kunstschaffender: In den eigens für die Ausstellung produzierten Videoporträts von spot_the_silence sprechen Schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden, People of Color und Migrant*innen aus Ost und West über ihre Erfahrungen mit der Wende. Hito Steyerls essayistische Filmcollage „Die leere Mitte“ (1998) zeichnet anhand der Architekturgeschichte Berlins nach, dass die Kehrseite der Konstruktion einer Nation häufig rassistische und antisemitische Grenzziehungen sind. Der Fotograf Malte Wandel macht mit seiner Arbeit „Einheit, Arbeit, Wachsamkeit (2009–2019)“ einen Dialog mit Olga Macuacua und Nelson Munhequete sichtbar, die in den 1980ern als Vertragsarbeiter*innen aus Mosambik in die DDR migrierten. Die nicht-weißen Wendeerzählungen in den Arbeiten veranschaulichen mitunter auf schmerzhafte Weise, dass die deutsche Vereinigung gewaltvolle Ausschlüsse mit sich brachte – und zwar von Menschen, die nicht mitgemeint waren, wenn vom neuen deutschen „Wir“ die Rede war. Eine Gewalt, die nicht erst in den 1990er Jahren einsetzte, wie es die unter dem Hashtag #baseballschlägerjahre versammelten Berichte mitunter nahelegten, sondern die sich aus der Verbindung spezifisch ost- und westdeutscher Konstellationen und Kontinuitäten von Rassismus und Nationalismus ergab und wechselseitig verstärkte.
Der vorliegende Text befasst sich als eine Art Ausstellungsrundgang mit der Frage, inwiefern das exklusive Einheits-Wir an bereits bestehende Ideologien der Ungleichwertigkeit andocken konnte.
Zwischen Euphorie und Schwindel – oder: „Was wollt ihr denn hier? Das ist unsere Vereinigung“
Es ist ein mächtiges „Wir“, das am Anfang der Wende-Erzählung steht und zunächst im emanzipatorischen Slogan „Wir sind das Volk“ in Erscheinung tritt. Jener Slogan steht wie kein anderer für die Hoffnungen, mit denen Bürger*innen der DDR auf die Straße gingen, um einen „selbstbestimmten Neuanfang“ (Sabrow 2019: 32) einzufordern und auf friedliche Weise die Grenzöffnung zu erkämpfen. Auch die Schwarze Wissenschaftlerin Peggy Piesche ging 1989 mit auf die Straße. Die Besucher*innen der Ausstellung begegnen Piesche im Videointerview mit spot_the_silence (2019). Sie erinnert sich an eine „Euphorie der Revolution“ nach der Maueröffnung. Ganz unterschiedliche Menschen seien damals auf die Straße gegangen, getragen von der Erleichterung darüber, dass das Regime nicht gewaltsam zurückgeschlagen habe. Diese euphorische Stimmung beobachtete auch Sanem Kleff, die Pädagogin und heutige Vorsitzende des Vereins „Courage“. Sie lebte damals in West-Berlin. Im Interview schildert sie, wie die Grenzöffnung in ihrer migrantischen Community erlebt wurde:
In dieser euphorischen Stimmung gab es ein ganz großes Mitgehen, Emphatisch-sein, Nachvollziehen, sich Freuen für die Anderen. Es wurde verstanden als eine Familienzusammenführung. Das waren nicht nur politisch fiktive Gruppen. Natürlich ist viel Leid geschehen durch die Trennung, durch das Auseinanderfallen. Und jedes Leid steht für sich und ist zu sehen. Und deshalb gab es eine große Empathie. Gerade auch, weil die Deutschen sich ja so liebenswert zeigten, emotional, einander zugewandt, mit Tränen in den Augen. Menschlich.
Zugleich musste sie jedoch feststellen, dass das dominante „Wir“, welches seine Vereinigung feierte, sich am 9. November auf den Straßen Berlins ihr gegenüber ausgrenzend verhielt:
Die meisten Menschen hatten Bierdosen, Sektflaschen in der Hand, blieben zwischendurch stehen, prosteten sich zu, klopften jeder Beliebigen auf die Schulter, sangen, umarmten sich. Es blieb nicht aus, dass der eine oder andere auch auf mich zuging und mich anlächelte, mir etwas zurief. Doch sobald ein Blickkontakt hergestellt worden war, änderte sich irgendetwas. Eine Geste blieb unausgeführt, der Blick wendete sich ab, der Satz wurde nicht zu Ende gesprochen. Dies geschah nicht nur einmal oder zweimal, sondern viel zu oft. Sind das die Menschen, mit denen ich mich mitgefreut hatte, dachte ich enttäuscht.“ (Kleff 1990: 5)
Im Interview für die Ausstellung ergänzt sie, dass auch Sätze gefallen seien wie: „Was wollt ihr denn hier? Das ist unsere Vereinigung!“ Ähnliche Erfahrungen beschreibt Peggy Piesche. Die besondere euphorische Stimmung auf der Straße bestand für sie nur einige wenige Tage:
Ich habe noch eine ganz klare Erinnerung daran, wann das für mich gekippt ist. In Erfurt, als in diesen Demonstrationen vor allem auch vor der Stasi-Zentrale die Skandierung nicht mehr ‚Wir sind das Volkʻ war, sondern hin zu ‚Wir sind ein Volkʻ und ‚Deutschland den Deutschenʻ ging. Und schon in dieser kurzen Zeit – es war nur vielleicht zwei Wochen oder so – wusste ich schon, das ist nicht mehr mein Raum. Da bin ich nicht mehr mitgemeint. Und da habe ich mich auch nicht mehr sicher gefühlt. Ich bin dann auch nicht mehr hingegangen.
Bereits die Euphorie über die Grenzöffnung war verbunden mit einer Gewalt, die jene traf, die ohnehin zu den besonders verletzlichen Personengruppen in der Gesellschaft zählten. Schnell wurde aus dem Volk „als dem Träger politischer Macht gegenüber dem SED-Regime“ ein „deutsches Volk mit dem Bekenntnis zu einer deutschen Nation“ (Kleff et al. 1990: 1). Die Arbeiten in der Ausstellung legen dabei einen Schwerpunkt auf Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus in der DDR.
Antifaschismus, Antiimperialismus und andere Mythen
„Die DDR ist ja nicht vom Himmel gefallen“, bringt es Anetta Kahane im Interview mit spot_the_silence auf den Punkt. Die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung betont, dass die DDR – allem antifaschistischen Anspruch zum Trotz – ein Nachfolgestaat und eine Nachfolgegesellschaft des Nationalsozialismus mit entsprechenden Prägungen gewesen sei. Diese Aspekte einer postnationalsozialistischen Gesellschaft fallen im Erinnern an die DDR meist unter den Tisch. Da bildete das Jubiläumsjahr 2019 keine Ausnahme. Im Gegenteil: Von einer Reihe von Politiker*innen, Journalist*innen und Kommentator*innen wurde das ostdeutsche „Wir“ zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, der mit den Wahlen in Sachsen und Thüringen just in ein Superwahljahr fiel, sorgsam auf die Couch gelegt, hinsichtlich seiner Wahlbereitschaft für die rechtspopulistische und in weiten Teilen rechtsradikale AfD befragt und intensiv analysiert. Die Diagnose lautete recht einstimmig: Wendeenttäuschung.
Ohne die schmerzhafte Erfahrung uneingelöster Revolutionsversprechen und des Scheiterns eines wahren demokratischen Aufbruchs von der Hand zu weisen, will die Ausstellung die weite Verbreitung rassistischer, antisemitischer und menschenfeindlicher Haltungen unter ostdeutschen Bürger*innen allerdings nicht monokausal von der Diskriminierungserfahrung als „Bürger zweiter Klasse“ im westdeutsch dominierten wiedervereinigten Deutschland verstanden wissen, oder gar einer „Ostdeutschenfeindlichkeit“ das Wort reden, wie es z. B. die Autorin Jana Hensel (2018) vorschlägt. Die Ausstellung richtet den Blick vielmehr auf die Kontinuitäten menschenfeindlicher Positionen einerseits und die Vielfalt der DDR-Gesellschaft andererseits. Sie thematisiert, dass die Wende unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen, Milieus, Szenen und Communitys hatte und problematisiert, dass zu den vielfältigen Erfahrungen in und mit der DDR eben auch gehörte, dass Antisemitismus und Rassismus nicht besprechbar waren. In der DDR waren sie aufgrund des offiziellen Staatsantifaschismus mit einem wirkmächtigen Tabu belegt. Kahane berichtet über das Opfernarrativ der DDR:
Was die DDR-Gesellschaft oder die Politik dort gemacht hat, war, sie hat gesagt: Alle waren Opfer, vor allen Dingen die deutsche Arbeiterklasse. Opfer der Verführung durch die Hitler-Faschisten. Der Faschismus ist wie eine Nacht über uns hereingebrochen, hat Erich Honecker immer gesagt, so wie ein Naturereignis. […] In diesem Opfernarrativ ist die DDR groß geworden, sind die Leute groß geworden. Wer Opfer ist, ist nicht verantwortlich, wer nicht verantwortlich ist, empfindet weder Verantwortung noch kann er welche produzieren.
Von verschiedenen Erfahrungen mit Antisemitismus berichtet im spot_the_silence-Interview Uwe Dziuballa, der in Chemnitz ein koscheres Restaurant betreibt. In der Universität in Chemnitz habe er immer wieder mit antisemitischen Beleidigungen zu kämpfen gehabt. Einmal, als er nach der Vorlesung seinen Mantel holte, habe in der Tasche ein Zettel gesteckt mit der Botschaft „Judensau“. Sobald es um Israel ging, so Dziuballa, habe es immer gleich geheißen: „Die israelische Armee – alle Kindermörder!“. Der staatlich verordnete Antifaschismus schloss Israelhass und israelbezogenen Antisemitismus in der DDR nicht aus, mehr noch wurden diese vom Regime im Kampf gegen Imperialismus und Zionismus sogar explizit gepflegt (vgl. Herf 2019 sowie Beitrag von Thiele in diesem Band). Dass der Antiimperialismus der DDR mit seinem Leitbild der internationalen Solidarität sich zu Hause, in der Realität der ostdeutschen Provinz, allzu oft als Mythos entpuppte, schildert wiederum Peggy Piesche. Als Schwarzes Kind in einer Kleinstadt in Thüringen sei zwar der Anspruch internationaler Solidarität eines von wenigen Identifikationsangeboten gewesen. Jedoch habe sie bereits als Kind merken müssen, dass diese Solidarität eher zu Image- und Propagandazwecken gepflegt wurde:
Ich war im Prinzip immer das Abbild für diese Solidarität. Und das ist ein Anderungsprozess2. Kinder verstehen das sehr wohl, auch wenn sie keine Worte dafür haben, dass sie bei internationaler Solidarität nicht gleichwertig mitgedacht werden, und damit war dieser kleine Möglichkeitsraum eines Angebots auch schon wieder dahin.
Die Solidarität mit den in der antiimperialistischen Weltsicht vom Imperialismus und Kolonialismus betroffenen „Völkern“ ist institutionell u. a. in zwei Verträgen verankert, die die DDR 1979 und 1980 mit den Sozialistischen Republiken Mosambiks und Vietnams schloss. Auf dieser Grundlage migrierten bis 1989 u. a. rund 20.000 Mosambikaner*innen und rund 60.000 Vietnames*innen als sogenannte Vertragsarbeiter*innen in die DDR. Mit dem Versprechen, eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung zu erhalten, waren die Menschen angeworben worden. Die Realität sah jedoch in den meisten Fällen anders aus. Teilaspekte der komplexen Geschichte der Vertragsarbeiter*innen begegnen den Besucher*innen der Ausstellung einmal im spot_the_silence-Interview mit Mai-Phuong Kollath, und dann noch einmal in Malte Wandels Dialog mit den ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeiter*innen Olga Macuacua und Nelson Munhequete.
Als Olga Macuacua 1986 in Berlin Schönefeld landete, hatte sie noch keine Informationen darüber, wo und in welchem Beruf sie ausgebildet werden sollte:
Wir waren total unvorbereitet. Ich konnte kein Wort Deutsch. In Dresden sollten die Mosambikaner im Fleischkombinat arbeiten, doch ich wollte das auf keinen Fall. Eigentlich hatten wir keine Wahl, aber ich wurde mit 28 anderen Frauen nach Freital gebracht, um im Glaswerk zu arbeiten. Wir sind nur zwei Wochen in eine Schule gegangen und haben etwas Deutsch gelernt. Wir haben keine weitere Ausbildung erhalten. Wir sollten eigentlich sofort arbeiten.
Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Vertragsarbeiter*innen waren durch Ausbeutung und rassistische Ausgrenzungen bestimmt. Untergebracht wurden sie in Wohnheimen, in denen sie stark reglementiert und kontrolliert wurden. Einen Großteil ihres Lohns behielten die Betriebe ein und leiteten diesen an den mosambikanischen Staat weiter. Der tatsächlich ausgezahlte Lohn durfte weder gespart noch an Angehörige geschickt werden, sondern musste in vorbestimmte Waren investiert werden. Eine Schwangerschaft galt als Grund für die Auflösung des Arbeitsvertrages.
Das private Leben war geprägt durch eine erzwungene soziale Ausgrenzung, wie sich Olga Macuacua erinnert:
Wir Mosambikaner sind schon auch viel in Discos gegangen und haben versucht, in unserer Freizeit was zu erleben, aber mit Deutschen haben wir nicht viel unternommen. Es war auch wirklich schwer. Unser Wohnheim wurde Tag und Nacht kontrolliert. Wenn wir es in unserer Freizeit verlassen wollten, mussten wir unseren Personalausweis und die Betriebskarte abgeben. Wir mussten uns immer an- und abmelden. Wenn wir über Nacht bleiben wollten, mussten wir das begründen. Es war eigentlich nur möglich, Verwandte, die in anderen Betrieben untergekommen waren, zu besuchen. So sind wir Mosambikaner unter uns geblieben. Wir hatten nur intensiveren Kontakt zu unseren deutschen Kolleg*innen. Weitere Freundschaften und Beziehungen sind kaum entstanden.
Die antiimperialistische Solidarität erwies sich ein weiteres Mal kaum mehr als eine Illusion. Nach dem Mauerfall verbanden sich in der DDR nicht bearbeiteter Antisemitismus und Rassismus mit Verlustängsten. Mai-Phuong Kollath erinnert sich an Aussagen ehemaliger Kolleg*innen: „Wieso bist du denn noch immer hier? Hau ab!“ Streiks und Unterschriftensammlungen wurden organisiert, die mit der Forderung nach sofortiger Entlassung der Vertragsarbeiter*innen verbunden waren, von denen viele erst einige Wochen oder Monate zuvor in die DDR gekommen waren, während andere schon lange dort arbeiteten (Berger 2005: 69).3
Gleichwohl sein Vertrag vorsah, dass er noch weitere Jahre in Deutschland arbeitet, erhielt Nelson Munhequete 1990 die Mitteilung, dass er zurück nach Mosambik kehren müsse. Zu diesem Zeitpunkt fühlte er sich sehr wohl in der DDR, eine abrupte Rückkehr war nicht geplant. Doch am 4. Oktober 1990 saß er in einem Flugzeug. Zurück in Mosambik entpuppte sich die viel beschworene Solidarität ein weiteres Mal als Staatspropaganda. Er erfuhr, dass er den einbehaltenen Anteil seines Lohns nie ausbezahlt bekommen würde. Ohne die Vertragsarbeiter*innen darüber zu informieren, hatte die Volksrepublik Mosambik einen Teil der Gehälter genutzt, um Staatsschulden bei der DDR zu tilgen. Bis heute organisiert Nelson Munhequete gemeinsam mit anderen ehemaligen Vertragsarbeiter*innen jeden Mittwoch Demonstrationen in Maputo, um auf die Situation der ehemaligen Vertragsarbeiter*innen aufmerksam zu machen.4
„Ein Raum wird vereint: Im selben Moment entstehen neue Grenzziehungen“
Sie haben gelacht und ihm kein Wort geglaubt, erzählt der Studierende Dong Yang in Hito Steyerls essayistischer Filmcollage „Die leere Mitte“5. Mit Ignoranz reagierten die Polizist*innen, als er ihnen berichtete, er sei aus rassistischen Motiven mit einer Waffe angegriffen und verprügelt worden. Die Feierlichkeiten zur Vereinigung am 3. Oktober 1990 in Berlin mochte er sich lieber nicht allein anschauen, zu groß die Wahrscheinlichkeit, wieder Gewalt zu erfahren. „Nach dem Mauerfall waren die Deutschen ganz aufgeregt […]. Für die Ausländer wäre es besser, wenn die Mauer noch da ist“, sagt Dong Yang in Steyerls Film.
Der Vereinigungsprozess setzte einen „völkischen Wahn“ (Kahveci/Sarp 2017: 48) mit einer überwältigenden alltäglichen Gewalt frei. Menschen, die diesem Hass ausgesetzt waren, mussten allzu häufig die Erfahrung machen, in ihrer Verletzbarkeit und Verwundbarkeit allein zu sein und „aus der gesellschaftlichen Solidarität und Empathie ausgegliedert“ (Kahveci/Sarp 2017: 48) zu werden. Begleitet wurde die neonazistische Gewalt zu Beginn der neunziger Jahre von ausgrenzenden Diskursen in Politik und Gesellschaft, betont der Historiker Patrice G. Poutrus im Interview mit spot_the_silence: Im Vorfeld der ersten gesamtdeutschen Wahlen im Dezember 1990 setzte die Union in ihrem Wahlkampf einen zentralen Schwerpunkt auf eine Verschärfung der Asyl- und Migrationsgesetzgebung. Sie führte damit eine Themensetzung fort, die in den öffentlichen Auseinandersetzungen in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik omnipräsent war und – so schreibt Poutrus an anderer Stelle – beinahe „jede wichtige Wahlentscheidung auf Bundes- und Landesebene“ (Poutrus 2019: 98) prägte. In einer besonders schwierigen Situation befanden sich nach der Maueröffnung die Vertragsarbeiter*innen: Die meisten von ihnen verloren ihre Arbeitsplätze, viele wurden in die Selbstständigkeit oder zur Ausreise gedrängt.6
Hier wuchs zusammen, was zusammengehört – so könnte man das Bonmot von Willy Brandt zynisch-überspitzt auch auf die rassistischen Dynamiken im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess übertragen: Die spezifische Ausgrenzungspraxis, die sich in der DDR etabliert hatte, traf auf sein bundesrepublikanisches Pendant – diese Gemengelage ergab schließlich die unter „Asylkompromiss“ verschlagwortete Neuregelung, mithin die Verschärfung der Asylgesetzgebung.
Die Auswirkungen dieser Diskurse werden in der Ausstellung über die Schilderung des persönlich Erlebten sichtbar. In der Arbeit von Malte Wandel spricht Olga Macuacua auch über den Mord an ihrem guten Freund Jorge João Gomondai, der ebenfalls aus Mosambik in die DDR gekommen war. In der Nacht zum Ostersonntag 1991 stieg Gomondai in den letzten Waggon einer Straßenbahn in Dresden. In der Bahn traf er auf eine Gruppe von Jugendlichen, die ihn angriffen, mit einem Messer bedrohten und dazu zwangen, aus der fahrenden Straßenbahn zu springen. Wenige Tage später verstarb er an den Folgen des Angriffes. Als Olga Macuacua nach dem Ende des öffentlichen Gedenkgottesdienstes mit den anderen Trauernden aus der Dresdner Kreuzkirche trat, wurden sie wüst beschimpft: „Ausländer raus! Ausländer raus!“, habe eine Gruppe von rechtsradikalen Demonstranten skandiert. „Wenige Wochen später ist mein Freund in einer ähnlichen Situation, wie sie Jorge erlebt hat, nur knapp einer Gruppe von randalierenden Rechtsradikalen entkommen“, sagt Macuacua. „Es war wirklich eine schreckliche Zeit.“
Kurz nach dem Tod Gomondais und zwei Monate, bevor in Hoyerswerda ein Wohnheim für mosambikanische Vertragsarbeiter*innen und Asylsuchende tagelang belagert und angegriffen wurde, schrieb die BILD-Zeitung Ende Juli 1991: „Die Deutschen sind weder ausländerfeindlich, noch sind sie Rechtsextremisten. Aber wenn der ungehemmte Zustrom von Asylanten weiterwächst, wird auch die Gewalt gegen sie zunehmen. Sind unsere Politiker unfähig, das zu begreifen?“ (Zitiert nach Herbert 2014: 94) Allein in den 14 Tagen nach den Pogromen in Hoyerswerda kam es in mehr als 20 Städten zu rassistischen Anschlägen und Übergriffen (Herbert 2014: 96). Am 6. Dezember 1992 einigte sich die schwarz-gelbe Regierungskoalition mit der sozialdemokratischen Opposition darauf, Artikel 16a des Grundgesetzes, welcher das Recht auf Asyl regelt, zu reformieren. In den Monaten zuvor war es in Rostock-Lichtenhagen zu Pogromen gekommen, in Mölln wurde auf das Haus der Familie Arslan ein Brandanschlag verübt. Im Sommer 1993 nahmen Bundestag und Bundesrat die geplante Änderung an. Das grundgesetzlich verankerte Recht auf Asyl wurde in einer Weise verschärft, die es Schutzsuchenden fast unmöglich machte, in Deutschland um Asyl zu bitten (Poutrus 2019: 179). In den Worten Peggy Piesches: „Wenn das Ergebnis der Lynch-Pogrome in Rostock-Lichtenhagen ein verschärftes Asyl-Gesetz ist, dann wissen wir, in welcher Gemengelage wir da eigentlich waren“. Von 1990 bis Juli 1993 starben mindestens 61 Menschen durch rechtsmotivierte Gewalttaten (Amadeu Antonio Stiftung o.J.).
Gegen das Vergessen! – „Dort wo die Mauer stand, steht jetzt ein Zaun“
„Mir ging immer durch den Kopf: Das ist zwar absolut richtig, dass die Mauer verschwindet“, erzählt Sanem Kleff im Interview. Jedoch betont sie, dass mit dem Fall der Mauer auch eine – gewissermaßen in Stein gemeißelte – Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen verschwand. Einen ähnlichen Gedanken verfolgt die Künstlerin und Wissenschaftlerin Hito Steyerl in ihrer essayistischen Filmcollage „Die leere Mitte“ , in der sie historisches Material mit Filmaufnahmen vom Gebiet zwischen Potsdamer Platz und Reichstag aus den Jahren 1990 bis 1998 verschränkt. An einer Stelle sagt die Erzähler*innenstimme: „Dort wo die Mauer stand, steht jetzt ein Zaun“. Die Fläche, die nach dem Bau der Mauer zum Todesstreifen geworden war, öffnete sich nach ihrem Fall und wurde zur größten innerstädtischen Baustelle Europas. Das politische und wirtschaftliche Zentrum der Macht kehrte zurück in die Mitte Berlins. Steyerls Film erinnert an die Geschichten dieser Orte, die immer auch mit Antisemitismus, Rassismus, Kolonialismus und Nationalsozialismus verwoben sind – Geschichten, die durch die baulichen Veränderungen jedoch unsichtbarer werden, leichter zu vergessen sind.
Auf je eigene Weise machen Sanem Kleff und Hito Steyerl so auf die Fragilität und Performativität von Erinnerung aufmerksam. Das, was gesellschaftlich erinnert wird und werden kann, wird immer wieder neu hergestellt und ist dabei nie losgelöst von Machtverhältnissen und Strukturen des „hegemonialen Nicht-Hörens und des Ignorierens anderslautende[r] Wahrnehmungen, Erfahrungen und Stimmen“ (Thomas/Virchow 2019: 62). Dies zu erkennen bedeutet gleichzeitig, ernst zu nehmen, dass Erinnerungsräume immer umstritten und vielfältig sind.
Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten bringen Unruhe in ein dominanzgesellschaftliches Erinnern an 1989/90, das allzu häufig Erfahrungen überschreibt, die Schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden, People of Color und Migrant*innen teilen. Sie sind Resonanzräume für diese Erfahrungen und – so ist zu hoffen – zugleich Resonanzverstärker, die dazu beitragen, ein emphatisches Zuhören aufseiten der Dominanzgesellschaft einzuüben. In diesen Erinnerungsräumen ist die „Wende“ weniger mit dem Begriff der „friedlichen Revolution“ verbunden. Vielmehr ist sie tief in der Geschichte verankert, als ein zentrales Kapitel antisemitischer und rassistischer Gewalt. Ein Nicht-Wissen-Wollen von dieser anderen Seite der Wende dient schlussendlich der Stabilisierung von Dominanzverhältnissen und Privilegien (Güleç/Schaffer 2017: 58–63).
Den Stimmen der Betroffenen dieser Gewalt zuzuhören heißt, Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus zu erkennen und ernst zu nehmen. Die Erfahrungen und Erzählungen von nicht-weißen Menschen 1989/90 im Kontext des deutsch-deutschen Vereinigungsprozesses helfen, die Entwicklung der rassistischen und antisemitischen Gewalt und des Rechtspopulismus bis heute besser zu verstehen.
1 Schwarz wird im Text großgeschrieben, weil es sich nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische Selbstbezeichnung handelt. Begriffe wie „farbig“ oder „dunkelhäutig“ lehnen viele der in Deutschland lebenden Schwarzen Menschen ab, weil es Begriffe sind, die im Kolonialismus geprägt wurden und abwertend konnotiert sind. Das großgeschriebene „Schwarz“ verweist darauf, dass es sich bei der Hautfarbe nicht um biologische Eigenschaften handelt, sondern um ein soziales Konstrukt, um gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten (vgl. Neue deutsche Medienmacher 2019: 14).
2 Der Begriff stammt aus der postkolonialen Theorie und beschreibt einen Prozess, in dem durch Worte und Taten eine mächtige „Wir“-Gruppe erst in der Abgrenzung zu einer Gruppe der „Anderen“ hergestellt wird. Der Gruppe der Anderen werden von der machtvollen Eigengruppe im Rahmen dieses Anderungsprozesses (englisch „othering“) bestimmte Eigenschaften zugeschrieben (z. B. wild, exotisch, rückschrittlich), wodurch ein positives kollektives Eigenbild (z. B. zivilisiert, rational, fortschrittlich) erzeugt werden kann. Der britische Kulturwissenschaftler Stuart Hall sagte einmal, dass die weißen Engländer nicht deshalb rassistisch seien, weil sie die Schwarzen hassen würden, sondern weil sie ohne die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind (vgl. Cheema 2017: 23).
3 Noch am 12. Oktober 1989 beschloss das Präsidium des Ministerrats der DDR die Einreise von 6.000 zusätzlichen Arbeiter*innen aus Mosambik zum Einsatz in den sozialistischen Betrieben der DDR (Lubanda 2012).
4 Ausführlicher ist das Gespräch zwischen Nelson Munhequete und Malte Wandel in Wandel (2018) dokumentiert.
5 Vgl. zu Hito Steyerls Arbeit auch Deniz Utlus Essay (2015), den er anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls im Tagesspiegel veröffentlichte.
6 Mit dem Wegfall der SED-Herrschaft herrschte zunächst ein „rechtliches Niemandsland“ (Poutrus 2019: 159). Im Juni 1990 setzte die letzte DDR-Regierung eine Verordnung in Kraft, die es den Betrieben ermöglichte, Vertragsarbeiter*innen zu kündigen. Die Kündigung bedeutete gleichzeitig den Verlust des Wohnsitzes in den betriebseignen Wohnheimen. In der Arbeit von Malte Wandel erinnert sich die Vertragsarbeiterin Olga Macuacua daran, dass den Vertragsarbeiter*innen als Anreiz für eine Ausreise eine Summe von 3.000 D-Mark angeboten wurde. Die meisten ihrer Kolleg*innen nahmen das Angebot an, da sie ohne Arbeit und Wohnung zumeist keine Möglichkeit sahen, bleiben zu können. Die Rückflüge wurden meist von den Betrieben selbst organisiert. Häufig wurde das versprochene Geld erst im Transitbereich des Flughafens ausgezahlt, um so die Ausreise sicherzustellen (Webdokumentation Bruderland).

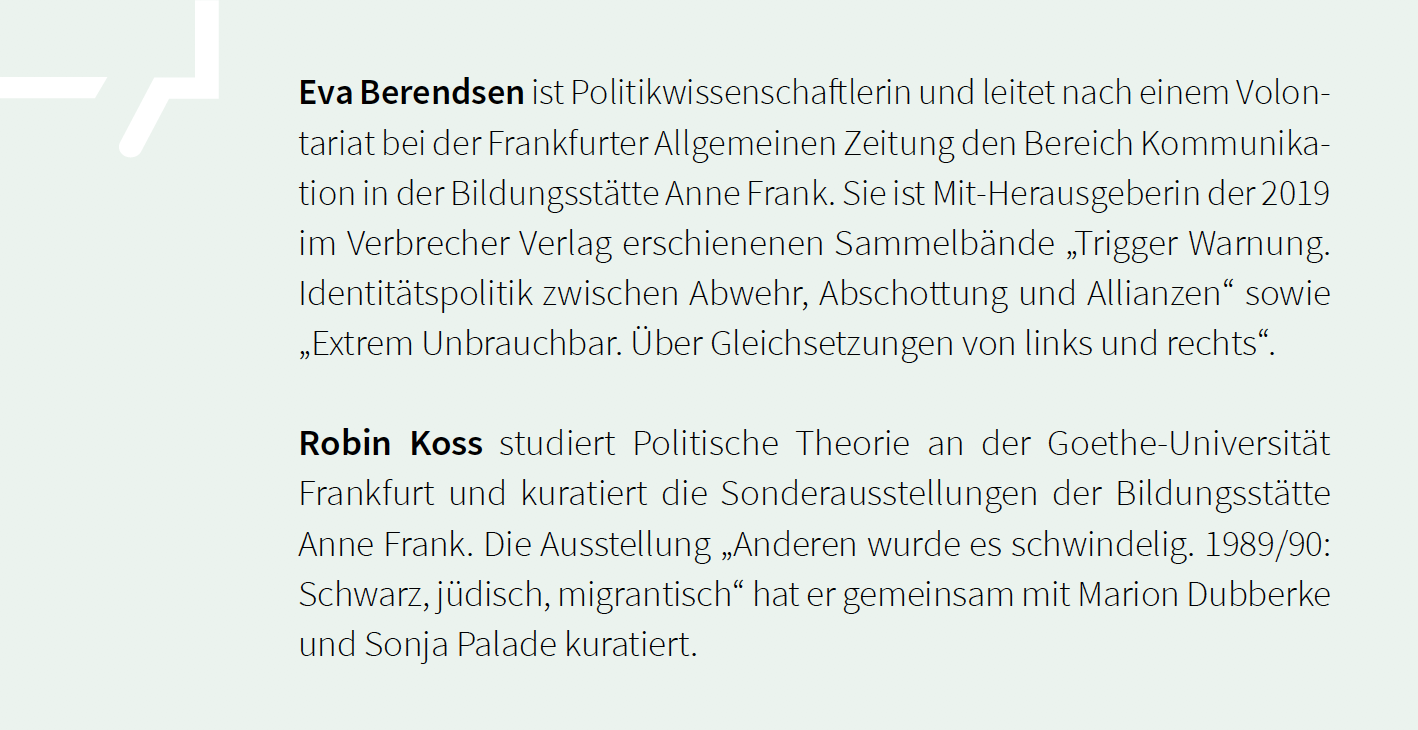
Literatur
Amadeu Antonio Stiftung (o.J.):
Todesopfer rechter Gewalt. Online: www.amadeu-antonio-stiftung.de/todesopfer-rechter-gewalt/ [19.12.2019].
Ayim, May (2012 [1993]): Das Jahr 1990: Heimat und Einheit aus afro-deutscher Perspektive. In: Piesche, Peggy [Hrsg.]: Euer Schweigen schützt euch nicht. Audre Lorde und die Schwarze Frauenbewegung in Deutschland. Orlanda Frauenverlag: Berlin, S. 53–68.
Bangel, Christian (2019):
Baseballschlägerjahre. Online: www.zeit.de/2019/46/neonazis-jugend-nachwendejahre-ostdeutschland-mauerfall [19.12.2019].
Berger, Almtuh (2005): Nach der Wende: Die Bleiberechtsregelung und der Übergang ins vereinte Deutschland. In: Weiss, Karin/Dennis, Nike [Hrsg.]: Erfolg in der Nische? Die Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland. LIT: Münster, S. 77–96.
Cheema, Saba-Nur (2017): Othering und Muslimsein: Über Konstruktionen und Wahrnehmungen von Muslimen. In: Zeitschrift Außerschulische Bildung, 48, Heft 2, 23–28.
Güleç, Ayşe/Schaffer, Johanna (2017): Emphatie, Ignoranz und migrantisch situiertes Wissen: Gemeinsam an der Auflösung des NSU-Komplexes arbeiten. In: Karakayalı, Juliane/Kahveci, Çağrı/Liebscher, Doris/Melchers, Carl [Hrsg.]: Den NSU-Komplex analysieren. Aktuelle Perspektive aus der Wissenschaft. Transcript: Bielefeld, S. 57–79.
Gürgen, Malene (2019):
„So vieles ist unerinnert“: Gespräch zum Mauerfallgedenken. Online: taz.de/Gespraech-zum-Mauerfallgedenken/!5637236/ [19.12.2019].
Hensel, Jana (2018):
Willkommen im Club. Online: www.zeit.de/politik/deutschland/2018-05/ostdeutschland-erfahrungen-migration-naika-foroutan/komplettansicht [19.12.2019].
Herbert, Ulrich (2014): Asylpolitik im Rausch der Brandsätze – der zeitgeschichtliche Kontext. In: Luft, Stefan/Schimany, Peter [Hrsg.]: 20 Jahre Asylkompromiss. Bilanz und Perspektiven. Transcript: Bielefeld, S. 87–103.
Herf, Jeffrey (2019): Unerklärte Kriege gegen Israel: Die DDR und die westdeutsche radikale Linke 1967–1989. Wallstein: Göttingen.
Kahveci, Çağrı/Sarp, Özge P. (2017): Von Solingen zum NSU: Rassistische Gewalt im kollektiven Gedächtnis von Migrant*innen türkischer Herkunft. In: Karakayalı, Juliane/Kahveci, Çağrı/Liebscher, Doris/Melchers, Carl [Hrsg.]: Den NSU-Komplex analysieren. Aktuelle Perspektiven aus der Wissenschaft. Transcript: Bielefeld, S. 37–56.
Kleff, Sanem (1990): „Wir sind auch das Volk!“: Die letzten zwölf Monate des geteilten Berlin aus der Sicht nicht-deutscher Berlinerinnen. In: Kleff, Sanem/Broszinsky-Schwabe, Edith/Albert, Marie/Marburger, Helga/Karsten, Marie [Hrsg.]: BRD – DDR. Alte und neue Rassismen im Zuge der deutschen Einigung. Verlag für interkulturelle Kommunikation: Frankfurt a.M., S. 3–17.
Kleff, Sanem/Broszinsky-Schwabe, Edith/Albert, Marie/Marburger, Helga/Karsten, Marie (1990): Vorwort. In: Dies.: BRD – DDR. Alte und neue Rassismen im Zuge der deutschen Einigung. Verlag für interkulturelle Kommunikation: Frankfurt a. M., S. 1–3.
Lubanda, Gabriele (2012):
Politische Beschlüsse zu Ausländerinnen und Ausländern in der DDR – eine exemplarische Übersicht. Online: www.auslaender-in-der-ddr.com/home/vor-der-wende/politische-beschlüsse/ [19.12.2019].
Neue Deutsche Medienmacher [Hrsg.] (2019):
NdM-Glossar: Wörterverzeichnis mit Formulierungshilfen, Erläuterungen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft. Online: www.neuemedienmacher.de/Glossar_Webversion.pdf [27.02.2020].
Poutrus, Patrice G. (2019): Umkämpftes Asyl: Vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart. Ch. Links Verlag: Berlin.
Sabrow, Martin (2019): „1989“ als Erzählung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 69, Heft 35–37, S. 25–33.
Thomas, Tanja/Virchow, Fabian (2018): Doing Memory und rechte Gewalt: Erinnern und Vergessen als Praxis und Ausgangspunkt für postmigrantisches Zusammenleben. In: Jalta – Positionen zur jüdischen Gegenwart, 4, Heft 2, S. 60–64.
Utlu, Deniz (2015):
Die Migranten, die Nation und ich: Essay aus Pegida Deutschland. Online: www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/essay-aus-pegida-deutschland-die-migranten-die-nation-und-ich/11209502.html [19.12.2019].
Wandel, Malte (2018): Nelson Munhequete: Begegnungen mit einem Madgerman. 2009–2017. Eine Text-Bild Collage. In: Liepsch, Elisa/Warne, Julian/Pees, Matthias [Hrsg.]: Allianzen. Kritische Praxis an weißen Institutionen. Transcript: Bielefeld, S. 220–243.