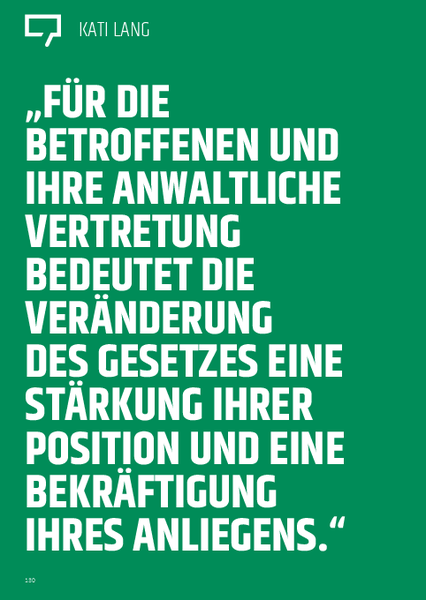Hinsichtlich der gesetzlichen Ausgestaltung in der Bundesrepublik kann man eine – wenn auch nicht ganz klare – Linie zwischen „Hate Speech“-Delikten und „Hate Crime“-Delikten ziehen. Während beispielsweise das Zeigen von Hitlergrüßen, das Tragen von Symbolen nationalsozialistischer Organisationen oder auch das Brüllen von „Sieg Heil“-Rufen schon lange strafbar sind, war eine gesonderte Bestrafung (Pönalisierung) von rechten, rassistischen Gewalttaten lange nicht gegeben.
Die Einschränkung der Meinungsfreiheit beruht auf historischem Kontext in Bezug auf extrem rechte Symbole und Parolen sowie die strafrechtliche Sanktionierung der Verherrlichung des Nationalsozialismus bzw. die Leugnung der Verbrechen der Nationalsozialist_innen. Es sei in Bezug auf die Kriminalisierung von Symbolen und Parolen im Bereich der §§ 86, 86a StGB klarstellend darauf hingewiesen: Diese Normen stellen keine Gesinnungsregelung dar, die nur auf nationalsozialistische Symbole fokussiert. Vielmehr ist das Zeigen, Verbreiten usw. von sämtlichen verfassungswidrigen, verbotenen Organisationen und Parteien erfasst – bspw. auch der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der in Westdeutschland verbotenen Freien Deutschen Jugend (FDJ) und anderer Organisationen, die im Laufe der Zeit verboten wurden. Als Sondernorm können allein Teile des Volksverhetzungsparagrafen (§130 StGB) gelten, insofern sie tatsächlich ausschließlich auf die Verbrechen des Nationalsozialismus abzielen. Ob man dies gut oder falsch heißt, ist wohl eine Frage des Standpunktes. Hier wird an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts1 aus dem Jahr 2009 angeknüpft, wonach ein Sonderrecht gegenüber der propagandistischen Gutheißung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft gerade aus den Lehren der Geschichte ausdrücklich zulässig ist. Wörtlich führte das Bundesverfassungsgericht aus:
"Angesichts des sich allgemeinen Kategorien entziehenden Unrechts und des Schreckens, die die nationalsozialistische Herrschaft über Europa und weite Teile der Welt gebracht hat, und der als Gegenentwurf hierzu verstandenen Entstehung der Bundesrepublik Deutschland ist Art. 5 Abs. 1 und 2 GG für Bestimmungen, die der propagandistischen Gutheißung des nationalsozialistischen Regimes in den Jahren zwischen 1933 und 1945 Grenzen setzen, eine Ausnahme vom Verbot des Sonderrechts für meinungsbezogene Gesetze immanent."
Es mutet befremdlich an, dass verbalisierte, zur Schau gestellte bzw. publizierte extrem rechte Tiraden in der Bundesrepublik gesondert bestraft bzw. pönalisiert werden – ebenso wie die Debatte um die Einführung einer Hasskriminalitätsnorm im Bereich von Gewaltstraftaten, die lange Zeit brauchte und eine große Gegnerschaft hat(te).
Erst in den 2000er Jahren gab es Versuche, insbesondere einzelner Bundesländer, eine entsprechende Norm im Strafgesetzbuch zu verankern. Mit der Zäsur der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) und geänderter politischer Mehrheiten wurde zum August 2015 eine veränderte Strafzumessungsregelung (§ 6 Abs. 2 StGB) ins deutsche Strafrecht implementiert. Die Regelung schreibt nun explizit vor, dass „rassistische, fremdenfeindliche und sonstige menschenverachtende Ziele und Beweggründe“ strafschärfend heranzuziehen sind. Inwieweit diese Veränderung Früchte trägt, kann derzeit nicht festgestellt werden. Empirische Justizforschung zum Themenfeld Hasskriminalität2 ist faktisch kaum existent. Insbesondere Staatsanwaltschaften und Gerichte entziehen sich bis heute einer wissenschaftlichen Betrachtung in Hinblick auf ihr Wirken im Umgang mit rechter, rassistischer Gewalt. Gegner_innen der Regelung betonten, dass schon die alte Strafzumessungsregelung ausreichend gewesen sei, nach der allgemein festgelegt war, dass die Motive und Beweggründe sowie die Gesinnung, die aus der Tat spricht, in die Strafzumessung einzubeziehen war. Die neue Regelung würde maximal eine bloße Klarstellungsfunktion haben und sei auch deswegen unnötig.
Auch wenn die empirische Lage zur Vorgängerregelung dünn ist, kommen zwei unabhängig voneinander geführte Studien zu vergleichbaren Ergebnissen: Für Baden-Württemberg untersuchte Glet (2011) in ihrer Dissertation 120 Straftaten aus dem Themenfeld „Hasskriminalität“ (2004 – 2008). Nur in 13 Prozent der erledigten Fälle wurde die Vorurteilsmotivation im Rahmen der justiziellen Bearbeitung ausdrücklich benannt und abschließend strafschärfend bewertet. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine durch Lang (2014) durchgeführte empirische Studie von rechtsmotivierten Gewalttaten in Sachsen in den Jahren 2007/08. Von 122 untersuchten Verfahren wurden dort nur bei 12 Prozent die vorurteilsmotivierten Beweggründe in die Strafzumessung einbezogen. Erklärungsansätze für diese unzureichende Praxis liegen in der allgemeinen Handlungsweise von Gerichten und Strafverfolgungsbehörden begründet, aber auch in einem speziellen Defizit im Erkennen von vorurteilsmotivierten Taten und im Umgang damit. So werden regelmäßig nur diejenigen Straftaten als „politisch motiviert“ erfasst, bei denen ein vorurteilsmotivierter Tatbezug offensichtlich erscheint, also quasi „ins Auge springt“. Es mangelt an Sensibilisierung – gerade im Hinblick auf die Botschaftsfunktion von Hasskriminalität besteht ein eklatanter Unterschied zur allgemeinen Kriminalität. Das führt schlussendlich dazu, dass die juristische Reaktion auf Hasskriminalität sich nicht vom Umgang mit allgemeiner Kriminalität unterscheidet.
Interessant ist jedoch, dass sich der Umgang durchaus unterschieden hat – je nachdem, welches Gericht zuständig war. So war etwa der allein entscheidende Strafrichter am Amtsgericht der Entscheidungsträger, bei dem vorurteilsmotivierte Beweggründe am wenigsten Einzug in die Entscheidung fanden. Dagegen konnte bei landgerichtlichen Erstentscheidungen die höchste Einbeziehungsquote festgestellt werden. Das mag bestimmten Umständen geschuldet sein, etwa Arbeitsbelastung, hohe Erledigungsquote, Massenverfahren. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass insbesondere die Amtsgerichte eine Vielzahl der vorurteilsmotivierten Straftaten abhandeln und daher in besonderer Verantwortung stehen. Seitens der Autorin wird – auch aus praktischen Erkenntnissen – die Änderung der Regelung nach August 2015 begrüßt. Gerade die Erfahrung aus der Vertretung von Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt zeigt: Die Justiz nimmt den Verweis auf den Zwang zur Motivermittlung im Rahmen der Regelung des § 46 Abs. 2 StGB unterschiedlich auf – von positiv gestimmt bis massiv ablehnend. Für die Betroffenen und ihre anwaltliche Vertretung bedeutet die Veränderung des Gesetzes eine Stärkung ihrer Position und eine Bekräftigung ihres Anliegens. Bis heute reagieren Gerichte und Behörden verwundert darauf, dass das Anliegen der Betroffenen meist kein finanzielles, sondern häufig vorrangig ein aufklärerisches Motiv ist. Auftrag der Betroffenen an die anwaltliche Vertretung im Verfahren ist zumeist die Aufklärung des Umstands, dass sie als völlig Unbeteiligte allein aufgrund eines (ihnen zugeschriebenen) bestimmten Merkmals Opfer einer Straftat wurden. Sie wollen eine starke Stimme im Verfahren sein und betonen, dass sie keinen Anteil an der entstandenen Situation hatten. Auch wenn der Nebenklage gerade in Verfahren im Bereich der Hasskriminalität von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten häufig mit Skepsis begegnet wird, ist der Faustpfand hilfreich, den das Gesetz nunmehr gibt, um die rassistische Tatmotivation in das Verfahren einzuführen. Gleichwohl soll nicht verschwiegen werden, dass es zahlreiche Beispiele einer guten Zusammenarbeit gibt. Nach wie vor sind Strafverfolgungsbehörden und Gerichte schwerpunktmäßig darauf fokussiert, die sogenannte objektive Tatbestandsseite aufzuklären. Sie verlieren dabei aber die Ermittlung der sogenannten subjektiven Tatbestandsseite aus dem Auge, insbesondere der Tatmotivation.
Häufig legen Beamt_innen im Ermittlungsverfahren zu wenig Aufmerksamkeit auf die Sicherstellung entsprechender Beweismittel. So werden beispielsweise im Rahmen von Hausdurchsuchungen CDs nicht durchgeschaut, Szenebekleidung nicht erfasst oder digitale Speichermedien nur oberflächlich ausgewertet. Dazu einige Beispiel: Aktuell wird in einem Verfahren am Landgericht Dresden ein Sprengstoffanschlag auf ein Gebäude verhandelt. Es wurde sowohl als Moschee genutzt als auch als Wohnung des Imans und seiner Familie. Der Staatsschutzbeamte, der die Speichermedien des Angeklagten ausgewertet hatte, konnte sich auch auf Vorhalt nicht mehr erinnern, dass sich eine Vielzahl rassistischer und den Nationalsozialismus verherrlichende Bilder auf den Speichermedien befunden hatten. Im Verfahren gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital konnte sich ein Polizeibeamter, der der Durchsuchung bei einem Angeklagten beigewohnt hatte, nicht mehr erinnern, dass dort eine Hakenkreuzfahne aufgefunden wurde; rassistische Aufkleber titulierte er als „Andenken“. Ausweislich der in einer Vielzahl von Verfahren gemachten Erfahrungen lässt sich konstatieren: Die Ermittlungsbehörden legen ihren Fokus nach wie vor zu wenig auf die beweisfeste Ermittlung der Motive und Beweggründe. In den Befragungen der Beamt_innen ergab sich, dass sie keine entsprechenden Fortbildungen besucht haben. Insofern bleibt es häufig einer engagierten Nebenklage überlassen, zur Aufklärung der Tatmotivation beizutragen und diese im Rahmen von Beweisanträgen in die Hauptverhandlung einzuführen. Das ist außerordentlich wichtig. Denn Taten der Hasskriminalität unterscheiden sich aufgrund ihrer (gewünschten) Wirkung als Botschaftsdelikte immens von allgemeiner Kriminalität. Sie wirken nicht nur auf die konkret von der Tat betroffenen Personen, sondern, und das ist ja gerade das Ziel der Taten, sie sollen Angst und Verunsicherung in der gesamten gesellschaftlichen Gruppe schüren, der das Opfer (vermeintlich) angehört. Der gesamten Gruppe soll gezeigt werden, dass sie nicht erwünscht ist und auch Gewalt mit dem Ziel der Vertreibung oder gar Auslöschung angewandt wird.
Als weiteren Aspekt haben die Taten eine destabilisierende Wirkung auf demokratisch verfasste Annahmen, da das Grundprinzip der Gleichheit und Freiheit aller (bspw. die Religions- und Meinungsfreiheit) angegriffen wird. Diese Aspekte stellt das Oberlandesgericht Dresden (Urt. vom 07.03.2018 – 4 St 1/16) in seiner Urteilsbegründung3 betreffend der Gruppe Freital ausführlich dar:
"Sprengstoffanschläge gegen Asylbewerberheime und das Eigentum von Flüchtlingsunterstützern führen dazu, dass ein Klima der Angst vor willkürlichen Angriffen erzeugt und eine große Unsicherheit darüber hervorgerufen wird, ob das friedliche und gewaltfreie Zusammenleben der Bevölkerung noch gewährleistet ist und die […] geschützten Rechtsgüter noch sicher sind. […] Die von den Angeklagten geplanten und durchgeführten Taten waren zudem geeignet, die Bundesrepublik Deutschland erheblich zu schädigen, was die Angeklagten ebenfalls wussten und wollten. Denn die systematische Begehung von Sprengstoffanschlägen gegen Asylbewerber und ihre Unterkünfte hätte einschneidende Auswirkungen auf die Gesellschaft und damit auch den Staat. Dies kann zu einer nachhaltigen und tiefgreifenden Schädigung der inneren Sicherheit der Bundesrepublik führen, wenn Asylsuchende allein wegen ihrer Herkunft verfolgt werden und sich nicht mehr sicher und geschützt fühlen können. Die Taten richteten sich ferner gezielt gegen Unterstützer von Flüchtlingen und politisch Andersdenkende und damit - vom Standpunkt der Angeklagten – ebenfalls einen nennenswerten Teil der Bevölkerung und nicht nur gegen einzelne Mitglieder der Parteien ‚Die Linke‘, […] oder ‚Bündnis 90/Die Grünen‘ […] sowie lokal aktive Flüchtlingsunterstützer, […] in Freital oder die Bewohner des alternativen Wohnprojektes […] in Dresden. Solche Angriffe sind geeignet, nicht nur die allgemeine Willensbetätigungsfreiheit einzuschränken, sondern auch die politische Auseinandersetzung und den politischen Meinungskampf von den – von der Verfassung vorgesehenen – Instrumenten (wie Versammlungen, Gremien, Parlamenten und Medien) hin zur bloßen Ausübung von Gewalt zur Durchsetzung eigener politischer Interessen zu verlagern. Es schädigt die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und erschüttert das allgemeine Vertrauen in die Wahrung elementarer Verfassungsgrundsätze, wenn Straftaten gegen politisch Andersdenkende oder karitativ tätige Menschen allein wegen Ihrer Ansichten und Handlungen durch Begehung entsprechender Katalogtaten begangen werden, um sie so in der sicheren und geschützten Ausübung ihrer Grundrechte zu behindern bzw. ihnen solche Rechte abzusprechen."
Eine solch deutliche Positionierung zur Wirkung von Hasskriminalität in Hinblick auf die gewollte Destabilisierung der demokratisch verfassten Gesellschaft trifft man in der Rechtsprechung eher selten. Sie darf insbesondere nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verfahren – wäre es nach der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft gegangen – einen ganz anderen Verlauf genommen hätte. Die oberste sächsische Strafverfolgungsbehörde hatte bereits Anklage beim Amtsgericht erhoben, Beiordnungsanträge der Nebenklage waren im ersten Anlauf abgelehnt worden und die Angeklagten sollten nur wegen einzelner Delikte verurteilt werden, und nicht wegen der Bildung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Erst als der Generalbundesanwalt das Verfahren übernahm, nahm es einen gänzlich anderen Verlauf. Einer der Angeklagten der Gruppe Freital bedauerte daher im Verfahren den Wechsel der Staatsanwaltschaft – man sei mit der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen doch auf gutem Weg gewesen und würde dann niemals vor dem Oberlandesgericht wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung sitzen. Dieses Verfahren zeigt geradezu beispielhaft, wie wesentlich die Rolle der Justiz ist, wie stark ihre Entscheidungen die Bewertung der Taten, ihrer Schwere und die Einbeziehung der Motivation beeinflussen.
Eine abschließende Bewertung hinsichtlich des Umgangs der Justiz mit Hasskriminalität fällt zum jetzigen Zeitpunkt schwer. Es mangelt an empirischen Studien nach der Gesetzesänderung. Die Justiz verschließt sich bis heute einer Statistik, die (vergleichend oder anknüpfend an die PMK-Statistik der Polizei) Aufschluss gibt über den Verlauf der Verfahren und somit den Umgang mit vorurteilsmotivierten Taten – und das trotz vielfach geäußerter Kritik und des eindeutigen Auftrags des NSU-Bundestagsuntersuchungsausschusses. Zwar beschlossen die Justizminister der Länder und des Bundes bereits im Juni 2013, „dass Straftaten, denen menschenverachtende Beweggründe zu Grunde liegen, bei den Staatsanwaltschaften als solche registriert und in statistischen Erhebungen der Justiz ausgewiesen werden“.4 Im Jahr 2015 wurde eine erweiterte Aktenübersendungsverpflichtung umgesetzt, und zwar an das Bundeskriminalamt bei bestimmten schwerwiegenden politisch motivierten Straftaten (Tötungs-, Brandstiftungs-, Sprengstoffdelikte). Die Bundesregierung musste jedoch einräumen, dass „die Änderung in der Praxis noch nicht die erwünschte Verbesserung des Informationsflusses (brachte)“5; insbesondere kam es hinsichtlich der Übersendung durch die Staatsanwaltschaften sowohl zu qualitativen als auch quantitativen Unterschieden.6 Jetzt soll nach Auffassung der Bundesregierung einerseits der Aufwand für die Behörden verringert und die Handhabung vereinheitlicht werden7; andererseits soll die Übersendungsverpflichtung an das Bundeskriminalamt (BKA) auf alle Fälle politisch motivierter Gewaltdelikte8 ausgeweitet werden. Allerdings wurde seit der im Jahr 2015 geäußerten Absichtserklärung kein wirklicher Fortschritt erzielt – maßgeblich, weil durch die Länder noch Klärungsbedarf bestehe.9 Insgesamt ist die Spannbreite im Umgang der Justiz mit Hasskriminalität als sehr breit einzuschätzen. Es bleibt aus Sicht der Autorin bei folgenden Problemen:
Erstens: Die Fokussierung liegt nach wie vor auf jenen Taten, die von den Behörden, aber auch der Gesellschaft als klassisch „rechte“ Taten erkannt werden. Damit sind insbesondere rassistische und antisemitische Taten gemeint – zunehmend auch Taten gegen Personen, die sich für ein demokratisches, diskriminierungsfreies Miteinander einsetzen. Die Spannbreite reicht hier von Politiker_innen bis hin zu Menschen, die sich in Flüchtlingsinitiativen engagieren. Selbstverständlich gibt es in diesem Bereich nach wie vor Verharmlosungs- oder Negierungstendenzen. Diese sind dann aber weniger – und dafür dient der NSU-Prozess sicher als sinnbildlichstes Beispiel – darauf gerichtet, die rassistische, rechte Tatmotivation prinzipiell zu bestreiten, als vielmehr eine weitergehende Aufklärung der Tatbeteiligung zu verhindern. Völlig unterbeleuchtet und nahezu nicht erfasst bleibt nach wie vor die Hasskriminalität gegen andere gesellschaftliche Minderheiten. Vorurteilsmotivierte Straftaten aus heteronormativen Beweggründen, also Delikte gegen Homo-, Trans-, Intersexuelle oder queer people, aber auch Straftaten gegen Obdachlose und sozial Ausgegrenzte oder Menschen mit Behinderung existieren in der Wahrnehmung quasi nicht. Die eingeschränkte Erfassung und Verfolgung von Hasskriminalität liegen in der Genese des deutschen Systems begründet. Es resultiert nicht aus dem Gedanken des Minderheitenschutzes, sondern hat seinen Ursprung im Staatsschutz und somit der Abwehr von „Extremismus“. Während rechte, rassistische und antisemitische Straftaten (relativ) unproblematisch unter das Verständnis von politisch motivierten Taten subsumiert werden, fehlt es – trotz eindeutiger Definition bspw. in der PMK – bis heute an der Sensibilisierung und Wahrnehmung von Straftaten gegen andere Minderheiten, und vor allem auch an entsprechender Strukturierung der Behörden. Für homo-/transphobe Straftaten mangelt es in einigen Bundesländern immer noch an spezialisierten Ansprechpartner_innen. Sozialdarwinistische Taten werden vorschnell als Milieutaten abgetan, die Aufklärung von Motivlagen wird zu wenig fokussiert.
Zweitens kommt es stark darauf an, an welcher institutionellen Ebene die Aufklärung und Verfolgung der vorurteilsmotivierten Tat angebunden ist. Wird die vorurteilsmotivierte Tat als eine solche erkannt und landet in der Bearbeitung beim polizeilichen Staatsschutz, ist zumindest sichergestellt, dass die Tatmotivation an irgendeinem Punkt eine Rolle spielt. Die Qualität der Ermittlung hängt dann stark von den sachbearbeitenden Beamt_innen ab. In Abhängigkeit der Straferwartung bestimmt sich die Zuständigkeit des Gerichts. Sowohl die empirischen Studien als auch Erfahrungswerte zeigen: Je höher die gerichtliche Ebene, desto mehr Sachaufklärung wird betrieben – umso wahrscheinlicher ist dann auch die Einbeziehung der Tatmotivation.
Drittens: Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist das Vorhandensein einer engagierten Nebenklage sowie die Begleitung durch spezialisierte Beratungsstellen. Der Nebenklage kommt insoweit eine verfahrensrelevante Rolle zu, als dass beispielsweise eine Vielzahl von Fällen aufgrund von Beschwerden wieder aufgenommen werden müssen, die sonst eingestellt worden wären. Die Nebenklage kann Beweismittel benennen und ins Verfahren einbringen, sodass die Betroffenen im Verfahren nicht bloße „Beweismittel“ in der Zeug_innenrolle sind, sondern aktiv Einfluss nehmen können. Die Nebenklage ist damit „Stimme der Betroffenen“ im Verfahren. Die Betroffenen selbst, Vertreter_innen der Nebenklage und die spezialisierten Beratungsstellen stellen nicht selten Öffentlichkeit her und kontextualisieren die Taten im gesellschaftlichen Raum.
Viertens: Die gesetzliche Regelung wird den Ansprüchen einer fortschrittlichen Regelung im Bereich der Hasskriminalität nicht gerecht. Während im Bereich der polizeilichen PMK-Statistik bezogen auf den Passus Hasskriminalität inzwischen eine recht ausgefeilte Definition vorliegt, bleibt die strafgesetzliche Regelung zu unkonkret. Sie läuft damit Gefahr, zu offen zu sein – und zugleich zu eng. So benennt sie relevante Tatmotivationen nicht konkret, etwa sozialdarwinistische, antisemitische, heteronormative oder antipluralistische Beweggründe, sondern fasst diese unter dem offenen Begriff der „sonstigen menschenverachtenden Beweggründe“. Dies geht fehl, weil damit der Aspekt der Botschaftsfunktion und somit der Grund für die gesonderte Strafzumessungsschärfung nicht benannt wird.
Fünftens: Immens wichtig bleibt das Thema Fort- und Ausbildung im Bereich Justiz sowie die kritische Reflexion und Begleitung justiziellen Handelns durch die Zivilgesellschaft. Denn ohne Sensibilisierung der Justiz geht die Implementierung der Norm ins Leere. Darüber hinaus ist eine dauerhafte kritische Begleitung der Verfahren durch die Öffentlichkeit von enorm wichtiger Bedeutung – das zeigen beispielsweise die Kommentierungen des NSU-Verfahrens oder des Prozesses gegen die Gruppe Freital. Es ergeht eben nicht nur ein nüchternes Urteil, sondern mit Rechtsprechung wird Politik gemacht und Geschichte geschrieben.
1 BVerfG, Beschl. v. 04.11.2009 - 1 BvR 2150/08.
2 Der Begriff der Hasskriminalität wird anknüpfend an die Benennung der Tagung verwandt. Auch wenn sich der Begriff zunehmend im deutschen Sprachraum durchsetzt, so ist aus wissenschaftlicher Sicht die Bezeichnung „Vorurteilskriminalität“ vorzuziehen (Vgl. den Beitrag von Coester in diesem Band – Anmerkung der Redaktion).
3 Das Urteil ist gegen zwei Angeklagte rechtskräftig, betreffend der weiteren Angeklagten ist derzeit noch das Rechtsmittelverfahren anhängig.
4
Beschluss Justizministerkonferenz, TOP II.4, 2013, Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister: Beschluss. TOP II.4: Konsequente Bekämpfung der Hasskriminalität. 12./13.06.2013. Online: www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-993.pdf;jsessionid=FCD2148A999146B6D94748FC4A912552.ifxworker [19.10.2018].
5 BT-Drs. 18/11339, S. 5.
6 Ebd.
7 BT-Drs. 18/11339, S. 5.
8 BT-Drs. 18/7830, S. 6.
9 BT-Drs. 18/11462, S. 5.
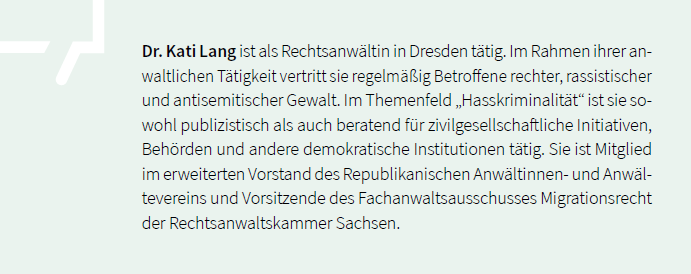
Literatur
Glet, Alke (2011): Sozialkonstruktion und strafrechtliche Verfolgung von Hasskriminalität in Deutschland: eine empirische Untersuchung polizeilicher und justizieller Definitions-und Selektionsprozesse bei der Bearbeitung vorurteilsmotivierter Straftaten. Duncker & Humblot: Berlin.
Lang, Kati (2014): Vorurteilskriminalität. Eine Untersuchung vorurteilsmotivierter Taten im Strafrecht und deren Verfolgung durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Nomos: Baden-Baden.