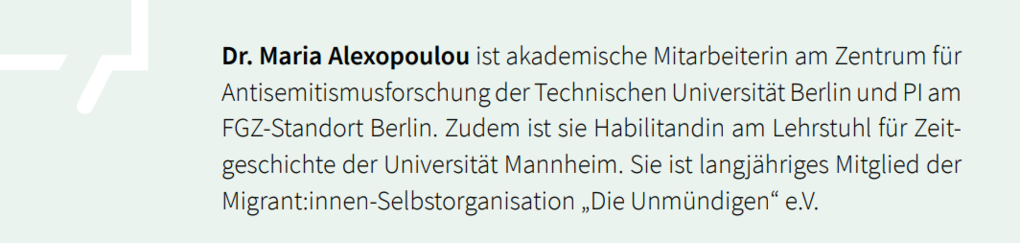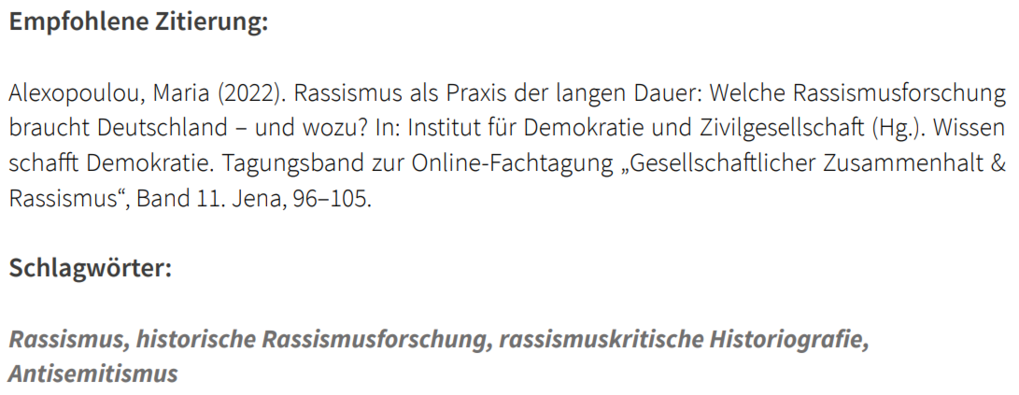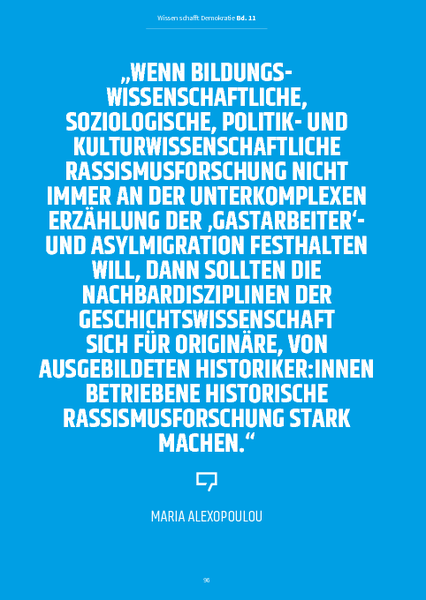Einleitung1
Die durch Halle, Hanau und Black Lives Matter erzwungene Diagnose „Deutschland hat ein Rassismusproblem“ durchdringt die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft Deutschland und adressiert ein Thema, das für die Bundesrepublik in ihrer Dimension als Migrations-, postmigrantische sowie als pluralistische demokratische Gesellschaft essenziell ist. Angesichts der Tatsache, dass wir heute wie nie zuvor in Teilen der Gesellschaft über Rassismus sprechen, stellt sich die Frage, ob sich etwas geändert hat, ob wir uns in einer Zäsur befinden und worin diese Zäsur besteht. Lernt die deutsche Gesellschaft gerade etwas (Neues) über Rassismus und wenn ja, was? Die Rassismusforschung, die durchaus Antworten auf diese Fragen gibt und geben will, steht in Deutschland allerdings auf tönernen Füßen: Die Theorie ist wenig durch empirische Forschung unterfüttert, dementsprechend bleibt schon ihr Gegenstand vage. Das Fehlen zeithistorischer Forschung für die Zeit nach der vermeintlichen „Stunde Null“ sticht dabei besonders hervor.
Aktuell stellt die Bundesregierung viel Geld für Rassismusstudien zur Verfügung, um Daten zu generieren, auf deren Grundlage Politik auf die Diagnose Rassismus reagieren kann. Doch welche Rassismusforschung braucht Deutschland heute überhaupt? Sollten wie schon in den letzten Jahrzehnten primär Einstellungen und damit die Symptome von Rassismus (bzw. der dafür etablierten Deckbegriffe wie Fremdenfeindlichkeit) erhoben werden, um das Individuelle statistisch zu kollektivieren und zu ordnen? Eine positive Neuerung ist, dass durch den Rassismusmonitor des DeZIM oder den kürzlich publizierten Afrozensus zumindest die Erfahrungen der Betroffenen aus einer rassismuskritischen Perspektive quantitativ erfasst werden. Doch welche grundlegenden Fragen können diese Daten klären, außer als diagnostisches Mittel zu fungieren, das ein Problem attestiert?
- Welche Fragen sollte sich Rassismusforschung in Deutschland darüber hinaus stellen? Aus meiner Sicht sind es zunächst diese:
- Was ist Rassismus? Ideologie, anthropologische Konstante, sekundäre Kapitalismusfolge, Macht-Wissen-Komplex, Form der Vergesellschaftung?
- Welche Kriterien machen Rassismus aus und was verbindet die einzelnen Rassismen miteinander?
- In welchem Verhältnis stehen Rassismus und Antisemitismus – vor allem in Deutschland?
Ich bin überzeugt, dass historische Rassismusforschung und rassismuskritische Historiografie einen entscheidenden Beitrag dazu leisten können, derartig grundlegende, im deutschen Kontext noch zu wenig adressierte Fragen zu bearbeiten. Dafür bräuchte es aus historiografischer Sicht:
- Eine breit angelegte zeithistorische Rassismusforschung, die sich nicht auf die zwölf Jahre Nationalsozialismus beschränkt, sondern die Zeit vor 1933 und besonders auch nach 1945 fokussiert. Das wurde bislang weder in der zeithistorischen noch in der migrationshistorischen Forschung in Deutschland ausreichend betrieben.
- Eine Fokussierung auf die historische Untersuchung von Rassismus als Praxis – weg von ideengeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Theoretisierungen und essayistischen Überblicken, hin zu mehr historischen Mikrostudien und deren Synopse.
- Die Zusammenschau der Verflechtungen von Rassismen in unterschiedlichen Zeiten, Orten oder betroffenen Gruppen und deren Analyse als ein in der jeweils untersuchten räumlichen Einheit (lokal, national, global) systemisch eingebettetes Phänomen.
Da der deutsche Kontext welthistorisch bedeutsam ist, wären die hier zu gewinnenden Erkenntnisse auch für die internationale Rassismusforschung essenziell. Doch diese Leerstellen sind nicht nur forschungsimmanent von Interesse. Ihre Bearbeitung hat darüber hinaus weitere Bedeutungen, etwa erinnerungspolitische, bildungspolitische sowie allgemeinpolitische und gesellschaftliche. Historiografisch generiertes Wissen würde diesen Bereichen eine weitere, bislang fehlende oder nur unscharfe zeitliche Dimension hinzufügen, an der u.a. sichtbar wird, dass die heute adressierten Problemfelder – institutioneller, struktureller, diskursiver, Alltags- und Gewaltrassismus – in historischen Traditionen und Kontinuitäten stehen. Daraus werden zum einen die Historizität und damit Wandel- und Adaptierbarkeit von rassistischem Wissen und rassistischen Praktiken erklärbar, zum anderen offenbaren sie, wie Rassismus in pluralistischen, demokratischen, „color-blind“, vermeintlich antirassistischen Gesellschaften überhaupt noch möglich ist.
Ich möchte einige erinnerungspolitische und danach einige wenige forschungspolitische Aspekte fokussieren.
Erinnerungspolitische Gedanken
Anders als in den Jahrzehnten zuvor, in denen die nach Deutschland vor Jahrzehnten Eingewanderten und die ihnen nachfolgenden Generationen durch Repräsentation in Museen und im „nationalen Narrativ“ Einlass in das kollektive historische Gedächtnis suchten, geht es aktuell um die Anerkennung und Erinnerung rassistischen Leids verschiedener historischer Dauer und geografischer Bezugspunkte. Historische und aktuelle Rassismuserfahrungen werden unter den Bezeichnungen anti-Schwarzer, anti-migrantischer, antimuslimischer und Gadje-Rassismus2 (bzw. Antiziganismus) sowie von einigen Betroffenen auch unter Antisemitismus verhandelt. Unter der Klammer „Dekolonisierung“ wird das Aufzeigen, Ent-lernen und Entfernen von Spuren rassistischen Wissens in der Wissensproduktion und im kulturellen Gedächtnis erstrebt.
Sofern mehrere Betroffenengruppen und ggf. Sympathisant:innen solidarisch agieren oder sich unter einem gemeinsamen Dach wie ‚Antirassismus‘ oder Migrantifa finden, scheint es einfacher, die verschiedenen erinnerungskulturellen Anliegen als eine Bewegung3 zu fassen. Aber gleichzeitig ist diese antirassistische erinnerungskulturelle Bewegung (sofern überhaupt als ‚eine‘ Bewegung zu fassen) sehr fragil. Diese Fragilität spiegelt sich auch in der Rassismustheorie in Deutschland selbst wider, die bislang kaum fundierte Theorie- und Forschungsansätze zur Verfügung stellt, die diese Phänomene für alle evident als einen Untersuchungsgegenstand fassen. Diese noch ausstehende theoretische Fundierung macht die damit artikulierte Forderung – Partizipation an der Erinnerungskultur – von außen angreifbar: nicht nur bei offen rassistisch argumentierenden oder die Existenz von Rassismus leugnenden Milieus, sondern auch bei „liberalen Universalisten“, die in den Anliegen einzelner Gruppen die Gefahr des Partikularismus, der Identitätspolitik und der Opferkonkurrenz aufkommen sehen oder die Rassismusvorwürfe als Luxusproblem emanzipierter Außenseiter:innen betrachten. Was dabei vergessen wird, ist, dass Rassismus tötet: ob man als Geduldeter aus Sierra-Leone zu Tode kommt wie Oury Jalloh, ob man Theodoros Boulgaridis heißt und einen kleinen Schlüsseldienst in München betreibt oder ob man in Hanau geboren ist, Gökhan Gültekin heißt und in einer Bar erschossen wird.
Dabei ist die historische Dimension der Rassismusgeschichten betroffener Gruppen nicht einmal adressiert. Für migrantische und nicht-migrantische Rom:nja reicht diese oftmals in den Nationalsozialismus zurück, genau wie für viele Griech:innen, die oder deren Familien die deutsche Besatzung erlebt haben, oder polnische Migrant:innen, die in mehreren Phasen deutscher Kolonialpolitik im Osten Europas, als Saisonarbeiter:innen im Kaiserreich und als Zwangsarbeiter:innen in zwei Weltkriegen, Rassismus in unterschiedlichen Eskalationsstufen erfahren haben.
Auf Podiumsdiskussionen mit Vertreter:innen verschiedener Gruppen zeigt sich das Problem, das ich hier adressieren möchte, immer wieder: Einzelne Sprecher:innen berichten die Rassismuserfahrungen ihrer Gruppe; doch im Ergebnis bleibt es bei partikularen Aussagen, die nebeneinander stehen, aber kaum zueinander in Beziehung gesetzt werden. Das verstärkt zum einen den Eindruck, dass der Rassismus, den die jeweilige Gruppe erfährt, primär mit ihr zu tun hat, Teil ihrer partikularen Geschichte ist. Das macht Rassismus aber letztlich zum Merkmal und damit auch zum Problem der Betroffenen, nicht zum Merkmal und Problem der Gesellschaft, die ihn hervorbringt. Zum anderen führt die Praxis des Nebeneinanderstellens der Rassismen dazu, dass die schwierigsten Fragen nicht durchdrungen werden. Das sorgt immer wieder dafür, dass Solidaritätsbündnisse scheitern und tatsächlich Opferkonkurrenzen aufkommen. Das kann allerdings auch Folge davon sein, dass Opfer von Rassismus oder Opfergruppen, die freilich allesamt nicht homogen sind, selbst rassistisch oder antisemitisch sein oder agieren können. Diese Konkurrenz wäre auf mindestens drei Wegen aufzulösen:
- erstens durch einen normativen Ansatz, nämlich indem aus der Perspektive einer herkunftsheterogenen Einwanderungsgesellschaft das moralische Recht anerkannt würde, jede Form von Rassismus zu erinnern, vor allem in Deutschland mit seiner exzeptionellen Rassismusgeschichte (und seiner so attestierten erinnerungspolitischen Erfolge),
- zweitens als gesellschaftspolitisches und demokratietheoretisches Gebot, dass aus der Erkenntnis erwachsen könnte, dass es zur Herstellung von gesellschaftlichem Zusammenhalt auch für alle Bevölkerungsgruppen des gleichen Zugangs zu Ressourcen bedarf – in dem Fall zur Ressource Erinnerung, die allen in der Gesellschaft Präsenten gleichermaßen zusteht,
- und drittens könnte das gemeinsame Erinnern auch aus der Aufarbeitung der Geschichte selbst folgen, sofern sich die historiografische Herangehensweise von einem vergleichenden und dabei auch bewertenden und wiederum hierarchisierenden Zugang löst, der bislang in den erinnerungspolitischen Debatten dominiert, und sich dem Ansatz entangled histories zuwendet: “unveiling the entanglement rather than […] comparing the entangled entities”, wie es der dekoloniale Denker Walter Mignolo ausdrückte (Mignolo 2013:10).
Dabei benötigen wir verschiedene Herangehensweisen: Zum einen die historiografische Durchdringung der einzelnen Rassismen, die von unterschiedlicher zeitlicher Reichweite und Genese sind. Zum anderen brauchen wir das historische Herausarbeiten der Überlagerungen von rassistischen Wissensbeständen: So etwa die Tatsache, dass der im 19. Jahrhundert hier in Deutschland so benannte Antisemitismus von Beginn an starke antislawische und anti-migrantische rassistische Implikationen hatte. In der Weimarer Republik gipfelte dies in der Figur des „Ostjuden“, der noch im „Dritten Reich“ am untersten Ende der Hierarchie der Herkünfte stand. Auch in der direkten Nachkriegszeit gehörten osteuropäische jüdische Displaced Persons zu den am meisten verhassten und später in der neuen Bundesrepublik in vieler Hinsicht diskriminierten Ausländergruppen, nach den polnischen „heimatlosen Ausländern“, die in ihrer Mehrheit Zwangsarbeiter:innen gewesen waren (Alexopoulou 2020). Schon an diesem Beispiel zeigt sich, dass sich die scheinbar klar voneinander abgetrennten Gruppen – Jüd:innen, Migrant:innen– historisch immer wieder überschneiden. Auch das verweist auf die „Verflechtungspotenz des Antisemitismus“, wie es Stefanie Schüler-Springorum genannt hat, die ihn historisch, aber auch aktuell mit anderen Rassismusformen verbindet – wobei die Verknüpfung mit dem antimuslimischen Rassismus ins Mittelalter und die Vormoderne zurückgeht (Schüler-Springorum 2020a: 56 und 2020b).
Die Konstanz von rassistischen Praktiken innerhalb des jeweiligen sich im Zeitverlauf verändernden Migrationsregime lässt sich am eindrücklichsten an der Geschichte der Schwarzen Deutschen und Schwarzen in Deutschland aufzeigen. Dies ist eine fast vollkommen ignorierte Geschichte, eine Geschichte der Ignoranz, die ebenso dazu beitrug, dass die Präsenz von Schwarzen in Deutschland weiterhin als etwas A-Normales gilt, sie somit das „Fremde“ an sich verkörpern, der Schwarze Mensch als Ausländer an sich. Dabei ist auch die physische Abwesenheit von Schwarzen Menschen in Deutschland, die in den Jahrzehnten davor etwa damit erklärt wurde, dass Deutschland vorgeblich keine Kolonialgeschichte hatte, Ergebnis davon, dass Schwarze stets auf eine der niedrigsten Stufe der Herkunftshierarchie gestellt wurden, so dass ihnen der Zugang und das Verbleiben in Deutschland gerade seit der Kolonialzeit enorm erschwert oder gar unmöglich gemacht wurden (Aitken/Rosenhaft 2015).
Aus den bestehenden historischen Archiven und den counterstories der Betroffenen lässt sich historiografisch der rote Faden herausarbeiten, der das Wesen des systemischen Rassismus innerhalb eines nationalstaatlichen Gebildes in seinen möglichen Eskalationsstufen offenbart. Gerade die Schnittmengen an derartigen Erfahrungen bergen das Potenzial, die Erinnerungsarbeit an rassistisches Leid als ein gemeinsames Projekt in Solidarität anzugehen, das den systemischen Rassismus aufdeckt, in dem der „normale Rassismus“ und der Radikalrassismus als zwei Enden eines sich historisch wandelnden Phänomens erfasst werden können.
Forschungspolitische Aspekte
Zwar ist Rassismus- und rassismuskritische Forschung keine Garantie für eine Verwissenschaftlichung der Debatte: Der aktuelle Backlash in den USA und Großbritannien äußert sich gerade darin, dass der Abbau oder gar die Abschaffung von Critical Race Studies gefordert wird (Tharoor 2021). In Deutschland mit seiner exzeptionellen Rassismusgeschichte existieren diese als eigene Denomination oder als Fachbereich universitär allerdings noch nicht einmal. Die akademische Welt kann zwar Rassismus nicht mehr ignorieren, dafür sind nun zu viele da, die kompetent darüber forschen, sprechen und gehört werden, aber sie kann Rassismuskritik und -forschung weiterhin diffamieren. Gerade deshalb ist es wichtig, die akademischen Bedingungen von Rassismusforschung mitzudenken. Immerhin gibt es in Deutschland bislang keinen einzigen Lehrstuhl für Rassismusforschung, in keiner der infrage kommenden Disziplinen. Die Prekarität der Forschung ist für die Rassismusforschung besonders ausgeprägt.
Welche Bedeutung sollte dabei der historischen Rassismusforschung und rassismuskritischen Historiografie zukommen? Die deutsche Geschichtswissenschaft, insbesondere die Zeitgeschichte sowie die historische Migrationsforschung, haben zur Rassismusforschung über lange Zeiträume nur wenig Substantielles beigetragen. Das Rassismusverständnis, das in wichtigen, aber letztlich vereinzelten Studien zum Tragen kam, war eng gefasst (z. B. Schönwälder 2001). Beiträge von in den USA forschenden Historiker:innen (z. B. Chin u. a. 2010), die die analytischen Konzepte race und racism auf die bundesrepublikanische Geschichte anwenden, wurden innerhalb der allgemeineren Zeitgeschichte, die Migration und Einwanderung ohnehin nur am Rand behandelt, kaum wahrgenommen. In der DDR-Forschung klafft ein noch größeres Forschungsloch. Zudem hat die Geschichtswissenschaft in Deutschland von der Soziologie zeitgenössisch zur Verfügung gestellte Konzeptionen kritiklos übernommen und deren Erklärungsmuster ohne eigene Untersuchungen reproduziert. Konzeptionen wie Ausländer- bzw. Fremdenfeindlichkeit und Fremdenangst interpretierten die gegen Migrationsandere gerichteten Hierarchisierungs-, Diskriminierungs- und Ausschlussmechanismen sowie in Konjunkturen auftretende Gewalt und offen ausagierten Hass als soziale bzw. psychosoziale Problematik oder gar als anthropologische Konstante. Damit wurden diese Phänomene erklärbar und gleichzeitig für die Politik operationalisierbar gemacht und normalisiert. Denn letztlich wurden (und werden) sie als Folge von Migration und damit als von außen kommende Probleme gefasst, also externalisiert und damit nicht als endogen und historisch gewachsen betrachtet. Migration, die historisch tatsächlich als anthropologische Konstante zu betrachten ist, wird somit ent-normalisiert. Diese Konzeptionen fungierten gleichzeitig als Barriere, die die historische Dimension der Verflechtung von Migration und Rassismus in Deutschland ausblendete – eine Barriere, die die deutsche historische Migrationsforschung ebenso durch die klare und an ordnungspolitischen Vorgaben orientierte Periodisierung und Kategorisierung von Migration und Migrant:innen lange Zeit übernommen und reproduziert hat.
Wenn also bildungswissenschaftliche, soziologische, politik- und kulturwissenschaftliche Rassismusforschung nicht immer an der unterkomplexen Erzählung der „Gastarbeiter“- und Asylmigration festhalten will, dann sollten die Nachbardisziplinen der Geschichtswissenschaft sich für originäre, von ausgebildeten Historiker:innen betriebene historische Rassismusforschung stark machen. Der retrospektive Blick ist essenziell, will man sich vor den aufkommenden culture wars wappnen: Denn quellenbasierte und intersubjektiv nachvollziehbare Nachweise zur langen Dauer, den zahlreichen Ausprägungen und Wirkweisen von rassistischem Wissen auf die Einwanderungsgesellschaft Deutschland sind nicht so leicht wegzuwischen und infrage zu stellen.
***********
1 In diesem verschriftlichten Vortrag finden sich Teile eines Textes der Autorin, der als Initialbeitrag für die Debatte 2021 des Rates für Migration e.V. erschien: rat-fuer-migration.de/2021/06/21/rfm-debatte-2021/ siehe auch Links zu den Kommentaren und zur Replik hier: rat-fuer-migration.de/rfm-debatte-2021/ (9.7.2022).
2 Zurzeit gibt es eine kontroverse Diskussion innerhalb der Betroffenenvertretungen und -sprecher:innen um die adäquate Bezeichnung des Phänomens. Siehe dazu z.B. einen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, in dem eher „Antiziganismus“ präferiert wird: Antiziganismus, Gadje-Rassismus oder schlicht Rassismus? Die Diskussion um die Benennung der Diskriminierung und Ausgrenzung von Sinti und Roma, www.bpb.de/mediathek/326875/antiziganismus-gadje-rassismus-oder-schlicht-rassismus (9.7.2022).
3 Eine derartige, noch im Aufbau befindliche Initiative ist Ver/sammeln antirassistischer Kämpfe: versammeln-antirassismus.org (9.7.2022).
4 So beispielsweise bei einer Podiumsdiskussion „Rassismus oder Rassismen“ auf der Jahrestagung des Rates für Migration im November 2020. Siehe Aufzeichnung des Podiums: rat-fuer-migration.de/2020/12/17/rfm-jahrestagung-2020-kritik-rassistischer-praktiken/ (24.1.2022).
Literatur
Alexopoulou, Maria (2020). Deutschland und die Migration. Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft wider Willen. Ditzingen, Reclam.
Aitken, Robbie/Eve Rosenhaft (2015). Black Germany: The Making and Unmaking of a Diaspora Community, 1884–1960. First paperback edition. Cambridge, Cambridge University Press.
Chin, Rita/Fehrenbach, Heide/Eley, Geoff/Grossmann, Atina (Hg.) (2010). After the Nazi Racial State: Difference and Democracy in Germany and Europe. Ann Arbor, University of Michigan Press.
Mignolo, Walter D. (2013). On Comparison: Who is comparing what and why?”. In: Rita Felski/Susan Stanford Friedman (Hg.). Comparison: Theories, Approaches, Uses. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 99–119.
Schönwälder, Karen (2001). Einwanderung und ethnische Pluralität: Politische Entscheidungen und öffentliche Debatten in Großbritannien und der Bundesrepublik von den 1950er bis zu den 1970er Jahren. Essen: Klartext.
Schüler-Springorum, Stefanie (2020a). Das Untote. Warum der Antisemitismus so lebendig bleibt und ist. Kursbuch Überleben 203, 53–64.
Schüler-Springorum, Stefanie (2020b). Missing Links: Religion, Rassismus, Judenfeindschaft. Jahrbuch für Antisemitismusforschung 29, 187–206.
Terkessidis, Mark (2004). Die Banalität des Rassismus: Migranten zweiter Generation entwickeln eine neue Perspektive. Bielefeld, Transcript.
Tharoor, Ishaan (2021). The U.S. and British Right Ramp up the War on ‘Wokeness’. The Washington Post vom 09.04.2021.