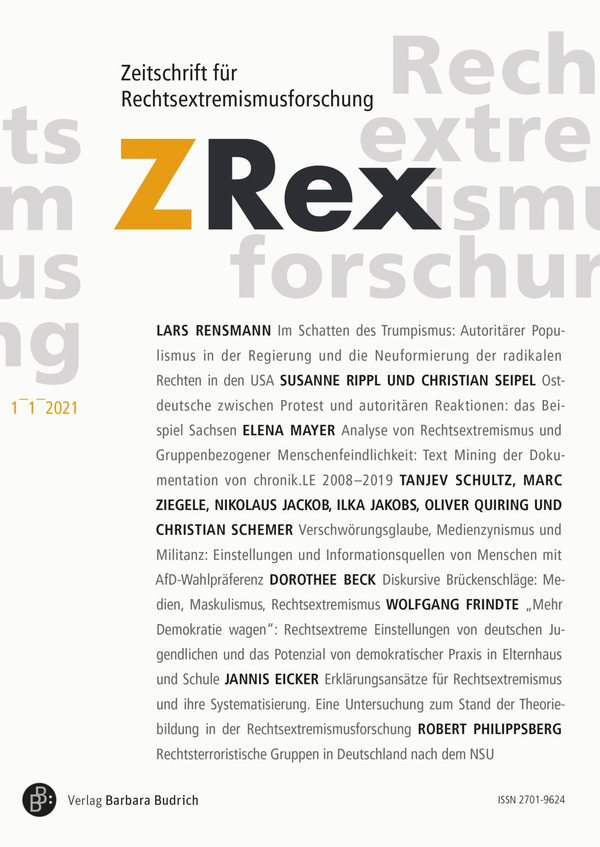Rechte Strukturen langfristig erforschen
Der Tagesspiegel/ mit Matthias Quent
Der Rechtsextremismus bedroht die Demokratie, die Forschung über ihn aber ist kaum institutionalisiert. Die Zeitschrift "zRex" behebt diesen Mangel.
Ziel der Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung ist es, der wissenschaftlichen Forschung zur illiberalen, populistischen bzw. extremen Rechten ein Forum zu geben und damit das strukturelle Defizit einer fehlenden wissenschaftlichen Plattform für kritische Rechtsextremismusforschung zu beheben. Die Zeitschrift soll Entwicklungen der illiberalen, populistischen bzw. extremen Rechten analysieren, gesellschaftstheoretisch erklären sowie Forschungsmethoden und -ethik sowie Handlungsfelder (Prävention, Intervention, Repression) in diesem Forschungsfeld einer Reflexion zugänglich machen. Die Zeitschrift steht interdisziplinären Zugängen sowie dem Austausch mit überschneidenden Forschungsfeldern offen – wie der Antisemitismus- und Rassismusforschung.
Die regionalen Schwerpunkte der Zeitschrift liegen auf Europa und den USA, zugleich ist die ZRex offen für Beispiele aus anderen Weltregionen. Die Beiträge sind in der Regel in deutscher Sprache verfasst, die Einsendung englischsprachiger Beiträge ist ausdrücklich erwünscht. Jeder Artikel enthält eine Zusammenfassung und Schlüsselbegriffe in deutscher und englischer Sprache, die dem Haupttext vorangestellt sind.
Die Zeitschrift erscheint zwei Mal pro Jahr im Verlag Barbara Budrich und ist sowohl als Open Access digital als auch als Printversion erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier.
Beiträge für die ZRex können als full paper jederzeit bei der Redaktion der ZRex eingereicht werden: redaktion@zeitschrift-rechtsextremismusforschung.de.
Die Zeitschrift veröffentlicht nur Originalbeiträge. Mit der Einreichung eines Manuskripts erklären die Autor*innen, dass ihr Artikel nicht bereits in einer anderen Zeitschrift oder an einem anderen Ort veröffentlicht oder eingereicht wurde. Ausführliche Informationen zu den Einreichungsmodalitäten finden Sie beim Verlag Barbara Budrich → Einreichungsmodalitäten.
Der Verlag behält sich das Recht vor, eingereichte Beiträge in einer späteren Ausgabe der Zeitschrift zu veröffentlichen, z.B. bei anderen, dringlicheren oder aktuelleren Themen.
Die Fachzeitschrift ist im Bereich Wissenstransfer angesiedelt. Der Austausch von Wissen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist ein zentrales Anliegen des Forschungsinstituts. Zur Projektbeschreibung auf der Website des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ).
Die siebte Ausgabe der ZRex (Jg. 4, Heft 1) ist am 25. März 2024 erschienen und nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Enthalten sind folgende Beiträge:
Auszehrung der Demokratie: Politik- und Regimeeffekte der radikalen Rechten in Osteuropa // Michael Minkenberg & Zsuzsanna Végh
„Konsortium der System-Propagandisten“. Rechtsextreme Publizistik und Medien-Selbstkontrolle am Beispiel von Österreich // Luis Paulitsch
Gegen die Zivilisation: völkischer Dezisionismus und historische Subjektivität in der äußeren Rechten // Max Manuel Brunner
Eine mikrosoziologische Analyse des Anschlags auf die Synagoge in Halle. Zur situativen Handlungsrelevanz von abwesenden Dritten // Chris Schattka
Alienation and authoritarian appropriation – the spatio-temporality of political subjectivation under East German urban neoliberalism // Leon Rosa Reichle
Das Themenfeld Rechtsextremismus in Kernlehrplänen und Schulbüchern des sozialwissenschaftlichen Unterrichts in NRW // Fabian Schneider & Karim Fereidooni
„Meine Zielgruppe ist das Volk.“ Die Querfront als populistische Strategie rund um Jürgen Elsässers Compact-Magazin // Martin G. Maier
Gesamtheft mit Rezensionen und Autor*innenhinweisen
Die sechste Ausgabe der ZRex (Jg. 3, Heft 2) ist im Oktober 2023 erschienen und nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Enthalten sind folgende Beiträge:
Gegen die „tödliche Dekadenz“: Agitation in Zeiten des Ukraine-Krieges am Beispiel von Björn Höcke / Sebastian Beer, Helen Greiner
Flucht in die Projektion. Zum Zusammenhang von Autoritarismus, Verschwörungsmentalität und rechtsextremer Einstellung / Marius Dilling, Johannes Kiess, Elmar Brähler
Die Konstruktion von Männlichkeit im extrem rechten Terror – eine tiefenhermeneutische Betrachtung des rechtsterroristischen Anschlags in Halle 2019 / Regula Selbmann
Wahrnehmungen und Verortungen recht(sextrem)er Positionierungen von Studierenden Sozialer Arbeit durch Lehrende / Julia Besche
„Aufstand der einfachen Leute“? Rechtspopulistische Proteste, politische Partizipation und politische Entfremdung in Sachsen / Susanne Rippl
„Demografischer Tsunami“ und „Willkommenskultur für Ungeborene“ – bevölkerungspolitische Diskurse der EU-Institutionen auf Twitter und die Rolle rechter und konservativer Kräfte / Judith Goetz, Swantje Höft, Livia Sz. Oláh, Andrea Pető
Gesamtheft mit Rezensionen und Autor*innenhinweise
Die fünfte Ausgabe der ZRex (Jg. 3, Heft 1) ist im April 2023 erschienen und nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Artikel im Heft
"Es ist ein geistiger Kampf": Predigten des Patriarchen Kirill im Kontext des Ukraine-Krieges // Hans-Ulrich Probst
"Gegen die moderne Welt". Julius Evola in Ungarn // Magdalena Marsovszky
Der Aufstieg des parteiförmigen Rechtsextremismus in russischer Nachbarschaft: der Fall Estland // Florian Hartleb
Introvertierte, querulantische Widerstandskämpfer gegen ein korrumpiertes System: Subjektivierung in Rechtsintellektuellen Diskursen // Malte Janzing
Antismitismus und Antifeminismus in Covid-19-Verschwörungsmythen // Philipp Polta
Antifeminismus und naturalisierte Differenzvorstellungen - Ergänzungen zur Messung antiegalitärer Überzeugungen // Mara Simon und Raphael Kohl
Wissenschaftsbezogener Rechtspopulismus/-extremismus an Hochschulen - Perspektiven von Betroffenen // Christoph Haker und Lukas Otterspeer
Gesamtheft mit Rezensionen und Autor*innenhinweise
Die vierte Ausgabe der ZRex (Jg. 2, Heft 2) ist ein Schwerpunktheft zum Thema Sozialarbeitsforschung. Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung der Disziplin Soziale Arbeit durch den Einbezug von Perspektiven der Rechtsextremismusforschung. Das Heft ist im Oktober 2022 erschienen und nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Artikel im Heft
Schwerpunkt: Sozialarbeitsforschung. Zur Weiterentwicklung der Disziplin Soziale Arbeit durch Einbezug von Perspektiven der Rechtsextremismusforschung
Editorial zum Themenschwerpunkt: Sozialarbeitsforschung. Zur Weiterentwicklung der Disziplin Soziale Arbeit durch Einbezug von Perspektiven der Rechtsextremismusforschung // Michaela Köttig, Esther Lehnert, Heike Radvan und Sebastian Winter
Einflussnahmen der extremen Rechten auf die Soziale Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern // Christine Krüger, Christoph Gille & Júlia Wéber
„Projektionsfläche rechtsextremen Gedankenguts“ – zur Dynamik des institutionellen Antiziganismus in der kommunalen Praxis // Tobias Neuburger
Schluss mit dem Dornröschenschlaf?! – Auswirkungen (extrem) rechter Orientierungen sowie menschenrechtsfeindlicher Handlungen auf Beratung // Marion Mayer
Zur Entpolitisierung von Männlichkeiten im Kontext des sozialpädagogischen Handelns mit rechten Jugendlichen Anfang der 1990er-Jahre // Lucia Bruns & Esther Lehnert
Rassistische Gewalt als Erfahrung der Markierung und Unsichtbarmachung // Gesa Köbberling
Offener Teil
Visuelles Framing im Compact-Magazin. Ergebnisse einer quantitativen Bildtypenanalyse // Felix Schilk & Gregor Gegenfurtner
Anastasia: Nährboden für rechte Ideologie // Lea Lochau
Gesamtheft mit Rezensionen und Autor*innenhinweise
Die dritte Ausgabe der ZRex (Jg. 2, Heft 1) ist im März 2022 erschienen und nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Artikel im Heft
Eine Woche im Herbst – Erinnerungspolitik als Zivilreligion am Beispiel der medialen Bearbeitung des Attentats von Halle (Saale) // Jakob Hartl und Maria Mahlberg
„Keine schwerwiegenden Vorfälle“ – Deutungen von Antisemitismus durch pädagogische Teams an Gedenkstätten zu ehemaligen Konzentrationslagern // Marina Chernivsky und Friedericke Lorenz-Sinai
Das Element der Nicht-Identität im Antiziganismus // Magdalena Freckmann
Japan als Vorbild der Neuen Rechten in Deutschland? Eine Analyse des Japanbilds in den Publikationen des Instituts für Staatspolitik // Stephanie Osawe
„Geil dabei zu sein“ – Livestreams als Kommunikationsmittel rechtsextremer Proteste“ // Linus Pook, Rocío Rocha Dietz und Grischa Stanjek
Extrem rechte Influencer*innen auf Telegram: Normalisierungsstrategien in der Corona-Pandemie // Pia Müller
Strategisches Framing bei Björn Höcke – wie ein rechtsextremer Politiker den Rahmen sprengt // Berit Tottmann
„Gender-Ideologie“ und „Klimahysterie“. Der Natur-Geschlechter-Nexus im rechten und extrem rechten Denken // Konstantin Veit
„Frauenrasse dominiert und wird bevorteilt an jeder ecke“ – Elemente rechtsextremer Diskursstrategien in der Online-Debatte über Abtreibungsrechte // Alina Jugenheimer, Carmen Pereyra und Sören Schöbel
Die zweite Ausgabe der ZRex (Jg. 1, Heft 2) erschien im Dezember 2021 und ist nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar sowie in gedruckter Form bestellbar.
Artikel im Heft
Politische Raumkultur als Verstärker der Corona-Pandemie? Einflussfaktoren auf die regionale Inzidenzentwicklung in Deutschland in der ersten und zweiten Pandemiewelle 2020 // Christoph Richter, Maximilian Wächter, Jost Reinecke, Axel Salheiser, Matthias Quent, Matthias Wjst
NSU, rassistische Gewalt und affektives Wissen // Çiğdem Inan
Mutterschaft als modernisiertes Inklusionsversprechen für Frauen. Extrem rechte Thematisierungen von Mutterschaft vor dem Hintergrund der Krise der sozialen Reproduktion // Maria Reusch
Antifeminismus als ‚Männerproblem‘? Eine sozialpsychologische Diskussion // Christopher Fritzsche
Die lebensweltorientierte Berufsidentität in Zeiten der „Furcht vor der Freiheit 2.0“ // Dennis Meller
Ausgestiegene in der Bildungsarbeit – eine kritische Betrachtung // Julia Besche
„Brecht den roten Uni-Terror!“ – ‚1968‘ im Visier der extremen Rechten // Fabian Virchow
Bürgerliche Natursehnsucht und faschistisches Potenzial: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Leo Löwenthal über das Desiderat Natur als Lebensnerv des Rechtsradikalismus // Tobias Wallmeyer
Extrem rechte Zugriffe auf die Arbeitswelt: eine kritischhermeneutische Untersuchung von Propagandamaterial von Zentrum Automobil und der Kampagne „Werde Betriebsrat“ // David Aderholz
Politische Raumkultur als Verstärker der Corona-Pandemie? Einflussfaktoren auf die regionale Inzidenzentwicklung in Deutschland in der ersten und zweiten Pandemiewelle 2020
Inhalt der Studie:
In der Studie wird untersucht, welchen Einfluss die politische Raumkultur auf regionale Unterschiede in den Inzidenzverläufen der Landkreise ausübt. Hierfür wurden die zwei Infektionswellen des Jahres 2020 in den 401 Kreisen und kreisfreien Städte in Deutschland anhand sogenannter „latenter Wachstumsmodelle“ analysiert. Hierdurch war es möglich herauszuarbeiten, welche Merkmale zu unterschiedlichen Zeitpunkten besonders starken Einfluss auf die Anstiege der Corona-Fallzahlen haben.
Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang der AfD-Zweitstimmenanteile auf die Anstiege der Infektionszahlen in beiden Wellen – sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Trotz der Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer Merkmale – wie Altersstruktur, wirtschaftliche Situation, Mobilität, Grenzregion etc. pp. – blieb der Zusammenhang zwischen AfD-Wahlergebnissen und Inzidenzen bestehen, so dass diese zahlreichen weiteren Faktoren als alternative Erklärungen ausgeschlossen werden konnten. Für andere im Bundestag vertretene Parteien lassen sich keine systematischen Effekte auf die Anstiegsphase beider Wellen finden. Die Untersuchung der Zweitstimmenanteile rechtsextremer Kleinparteien und die Nichtwählendenanteile zu den Bundestagswahlen 2005 und 2013 ergab ebenfalls positive Effekte auf die Inzidenzentwicklungen, was auf eine hohe Persistenz politischer und demokratischer Distanz in Teilen dieser Regionen hinweist.
Autor*innen
Die Studie ist im Rahmen des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt unter Zusammenarbeit eines Wissenschaftlers vom Helmholtz Zentrum München entstanden. Namentlich beteiligt waren Christoph Richter, Axel Salheiser und Matthias Quent (FGZ-Teilinstitut Jena/Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft), Maximilian Wächter und Jost Reinicke (FGZ-Teilinstitut Bielefeld/Universität Bielefeld/Fakultät für Soziologie) sowie Matthias Wjst (Helmholtz Zentrum München).
Pressemitteilung und Hintergrundinformationen
Pressemitteilung zur Studie (veröffentlicht am 19.11.2021) → Link
Hintergrundinformationen zur Studie → Link
Veröffentlichung
Der vollständige Artikel ist auf der Seite des Barbara Budrich Verlages abrufbar unter: https://doi.org/10.3224/zrex.v1i2.01A
Die erste Ausgabe der ZRex (Jg. 1, Heft 1) erschien am 28. Juni 2021 und ist nunmehr beim Barbara Budrich Verlag Open Access abrufbar und in gedruckter Form bestellbar.
Artikel im Heft
Im Schatten des Trumpismus: Autoritärer Populismus in der Regierung und die Neuformierung der radikalen Rechten in den USA // Lars Rensmann
Ostdeutsche zwischen Protest und autoritären Reaktionen: das Beispiel Sachsen // Susanne Rippl, Christian Seipel
Analyse von Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit: Text Mining der Dokumentation von chronik.LE 2008–2019 // Elena Mayer
Verschwörungsglaube, Medienzynismus und Militanz: Einstellungen und Informationsquellen von Menschen mit AfD-Wahlpräferenz – ein Beitrag zur Radikalisierungsforschung // Tanjev Schultz, Marc Ziegele, Nikolaus Jackob, Ilka Jakobs, Oliver Quiring, Christian Schemer
Diskursive Brückenschläge: Medien, Maskulismus, Rechtsextremismus // Dorothee Beck
„Mehr Demokratie wagen“: Rechtsextreme Einstellungen von deutschen Jugendlichen und das Potenzial von demokratischer Praxis in Elternhaus und Schule // Wolfgang Frindte
Erklärungsansätze für Rechtsextremismus und ihre Systematisierung. Eine Untersuchung zum Stand der Theoriebildung in der Rechtsextremismusforschung // Jannis Eicker
Rechtsterroristische Gruppen in Deutschland nach dem NSU // Robert Philippsberg
Die ZRex wird herausgegeben von einem Kreis von Wissenschaftler*innen aus Deutschland und Österreich (in alphabetischer Folge):
Der Tagesspiegel/ mit Matthias Quent
Der Rechtsextremismus bedroht die Demokratie, die Forschung über ihn aber ist kaum institutionalisiert. Die Zeitschrift "zRex" behebt diesen Mangel.
Wissenschaftlicher Leiter des IDZ
Kontakt:
Tel.: 03641/ 2719403
Mail: axel.salheiser[at]idz-jena.de