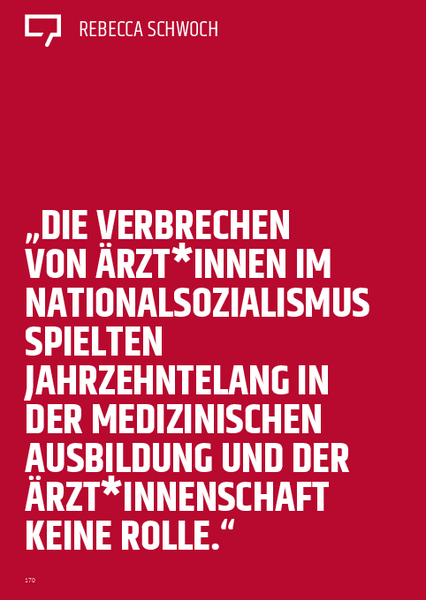Noch im Jahre 2001 hieß es, Medizinstudierende wüssten wenig über das dunkelste Kapitel der deutschen Medizingeschichte: die Verstrickungen und Verbrechen von Ärzt*innen im Nationalsozialismus. Diese Erkenntnis kristallisierte sich in einer Berliner Studie heraus, als semesterübergreifend 332 Studierende der Humanmedizin an der Humboldt-Universität nach ihrem Wissen und ihren Interessen am Thema Medizin im Nationalsozialismus befragt wurden (Stiehm 2002). Das Ergebnis war zum einen erschütternd, zum anderen aber auch wegweisend: Zwar war das Fachwissen nur mangelhaft, das Interesse an der Thematik jedoch groß. Beklagt wurde von den Studierenden, dass dieses Thema nicht nennenswert im Medizinstudium vorkomme.
Acht Jahre später wurden 216 Medizinstudierende im zehnten Studiensemester an der RWTH Aachen ähnlich befragt. Erneut sprach die enorme Diskrepanz zwischen mangelhaftem grundlegendem Wissen und vorhandenem Interesse eine deutliche Sprache. Auch dieses Mal sprachen sich die Studierenden dafür aus, dass die Rolle der Medizin im Nationalsozialismus fester Bestandteil der universitären Ausbildung sein sollte (Ohnhäuser et al. 2010).
Eine solche Verankerung gibt es jedoch bis heute nur insofern, als dass die Approbationsordnung für Ärzt*innen aus dem Jahre 2002 zwar einen Querschnittsbereich Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin als benotete Pflichtlehrveranstaltung vorschreibt, jedoch keine Angaben zu Inhalten, Anforderungen und Stundenzahl macht. Damit bleibt die Entscheidung über die Aufnahme des Themas Medizin im Nationalsozialismus in den Lehrkanon den jeweiligen Fachvertreter*innen überlassen.
Dass die Beschäftigung mit den Verstrickungen und Verbrechen von Ärzt*innen im Nationalsozialismus jahrzehntelang in der medizinischen Ausbildung und der Ärzt*innenschaft insgesamt keine Rolle spielte, ist symptomatisch für die „Solidar- und Vergessenskultur“ (Ash 2015: 325) unter Mediziner*innen: Versuche einer kritischen Aufarbeitung der Medizin im Nationalsozialismus prallten generell gegen eine Wand des Schweigens oder der Abwehr (Baader 1999). Das wiederum ist umso fataler, als gerade die deutsche „arische“ Ärzteschaft weit mehr als die Durchschnittsbevölkerung nationalsozialistisch organisiert war: 45 Prozent aller Ärzt*innen traten in die NSDAP ein, 7,3 Prozent in die SS, 31 Prozent in den bereits 1929 gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund (Kater 2000). Die deutsche Ärzt*innenschaft war von einem sozialdarwinistischen und rassenhygienischen Gedankengut durchsetzt. Die vielen, von Mediziner*innen organisierten, begangenen und zu verantwortenden Verbrechen bleiben das „Trauma des 20. Jahrhunderts“ (Riha 2013: 81).
Die Deutsche Ärzteschaft im Nationalsozialismus
1933 begann eine elitäre, antidemokratische, antisemitische, antifeministische, biologistische, rassenhygienische, völkische Politik, die viele ersehnten. Die Gleichschaltung, mit der das gesamte gesellschaftliche und politische Leben im NS-Staat vereinheitlicht und der nationalsozialistischen Ideologie unterworfen wurde, vollzogen die ärztlichen Standespolitiker für den gesamten Gesundheitsbereich rasch. Schon im ersten NS-Jahr wurden zentrale Organisationen der berufsständischen Selbstverwaltung auf dem Gebiet der Sozialversicherung gegründet. Die organisierte Ärzteschaft erlangte zügig einen zentralen Einfluss auf das gesamte Gesundheitswesen (Schwoch 2001: 92–132). Dazu gehörte der Kampf gegen politisch oppositionelle und jüdische Ärzt*innen, die eine Flut von gesetzlichen Maßnahmen traf, die von Jahr zu Jahr existenzbedrohender wurde. Repressalien und Terror reichten von Boykottmaßnahmen über Kündigungen und Verhaftungsaktionen bis zur Vertreibung aus der Gesellschaft bzw. aus dem Land. Die antijüdische Politik des NS-Staates vernichtete gezielt durch einen beispiellosen Raub die soziale Existenzgrundlage aller deutschen Jüd*innen und verursachte eine massive Verelendung. Der Kampf gegen die „verjudete Medizin“ endete 1938 im Entzug der Approbation aller jüdischen Ärzt*innen, die es damit offiziell nicht mehr gab. Um allerdings jüdische Zwangsarbeitende medizinisch versorgen zu können, wurde der „Krankenbehandler“ zur medizinischen Versorgung von jüdischen Patient*innen erfunden, um diese einigermaßen arbeitsfähig zu halten. Ab Kriegsbeginn wurde die Verfolgung der Jüd*innen extrem verschärft. Jüd*innen, denen bis dahin die Flucht ins Ausland nicht gelungen war, hatten von Monat zu Monat weniger Chancen, ein Aufnahmeland zu finden (Gruner 2000; Schwoch 2018).
Ein weiterer parallel verlaufender Strang der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik betraf den Kampf gegen „Minderwertige“, „Entartete“ und „Psychopathen“. Die Forderung, solche „Volksschädlinge“ zu sterilisieren oder gar zu töten, erwünschtes Erbgut hingegen zu fördern oder gar zu züchten, hat seine geistigen Wurzeln in der Eugenik – in Deutschland Rassenhygiene genannt – des 19. Jahrhunderts und war ein internationales Phänomen. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten diese Theorien wegen der schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation im Deutschen Reich einen deutlichen Aufschwung. Nicht nur unter Ärzt*innen oder in der Naturwissenschaft, sondern auch in der Politik und überhaupt in der Bevölkerung stieß rassenhygienisches Gedankengut zunehmend auf Akzeptanz (Tanner 2007).
Daran konnten die Nationalsozialisten anknüpfen und nutzten ihren Propagandaapparat, um die Angst vor einer stetig wachsenden Zahl an „Minderwertigen“ zu schüren. Bereits im Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, mit dem über 360.000 als „erbkrank“ klassifizierte Menschen zwangssterilisiert wurden. Zügig entstand ein flächendeckendes Netz von Einrichtungen, das die gesamte Bevölkerung nach „erbbiologischen“ Kriterien erfasste. „Erbgesundheitsgerichte“, aus Jurist*innen und Ärzt*innen bestehend, entschieden über die von Anstaltsleitern oder Amtsärzten gestellten Anträge zur Zwangssterilisation. Opfer dieser rassenhygienischen Maßnahmen waren psychisch Kranke, Menschen mit körperlichen Behinderungen, „Asoziale“ und andere als „minderwertig“ stigmatisierte Menschen. Ungefähr 5.000 Frauen und Männer starben an den Folgen, die durch Operationen oder Röntgenstrahlen in Krankenhäusern vorgenommen wurden. Viele Zwangssterilisierte wurden später im Rahmen der „Aktion T4“ ermordet (Bock 2010).
Diese Krankenmordaktion wiederum richtete sich gegen arbeitsunfähige, pflegeaufwendige und „störende“ Patient*innen in psychiatrischen Einrichtungen, von denen einige zu Tötungseinrichtungen mit Gaskammern wurden. All diese Morde, die zwar im Verborgenen ablaufen sollten, fielen in der Öffentlichkeit aber doch auf und führten zum Stopp der „Aktion T4“. Aber das Morden ging in Gestalt anderer Aktionen weiter. Am Ende hat das Töten durch Vergasung, Totspritzen, Vernachlässigung und verhungern lassen weit über 200.000 „lebensunwerten“ Menschen das Leben gekostet. Darunter waren auch mindestens 5.000 Kinder und Jugendliche, die in „Kinderfachabteilungen“ getötet wurden. Dieses Tötungsprogramm sollte von Anfang an auch für wissenschaftliche Untersuchungen in der Hirnforschung, Pathologie, Psychiatrie oder Genetik nutzbar gemacht werden (Fuchs et al. 2007; Klee 2010; Roelcke 2006).
Zu den medizinischen Verbrechen zählen ebenso die vielfach tödlich endenden und erzwungenen Menschenversuche in den Konzentrationslagern. Auch hier wurde im Namen der Wissenschaft die Möglichkeit eines grausamen Todes willentlich in Kauf genommen oder der Tod von Testpersonen wurde von vornherein einkalkuliert: Zwillingsexperimente, Unterdruck- und Unterkühlungsversuche, Fleckfieber-Impfstoff-Versuche, Tbc-Versuche und viele mehr. Konzentrationslager dienten als Experimentierfelder für Mediziner*innen, die genetische oder militärchirurgische Forschung betrieben, physiologische Experimente im Kontext der Luftfahrtmedizin durchführten, deren Ziel die Prävention oder Therapie von Seuchen oder die Herstellung von biologischen Kampfstoffen war. Tatsächlich stand die genuin wissenschaftliche Motivation über dem Respekt für die jeweiligen Menschen (Baumann 2010; Roelcke 2006). Es handelte sich nicht um vereinzelte Experimente oder einige Entgleisungen, sondern um eine große Anzahl menschenverachtender Experimente, die maximalen Fortschritt in der medizinischen Forschung versprachen. Wehrlose Menschen waren in diesem Rahmen nichts anderes als Forschungsmaterial (Baumann 2010: 21). Die exponiertesten Täter*innen (22 Männer und eine Frau) dieser humanexperimentellen Verbrechen im Nationalsozialismus standen 1946/1947 im Nürnberger Ärzteprozess vor Gericht.
Erste Versuche einer Auseinandersetzung mit der Medizin im Nationalsozialismus
Von den 23 in Nürnberg wegen schwerer Verstöße gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen Angeklagten, wurden sieben zum Tode und neun zu Haftstrafen verurteilt, sieben wurden freigesprochen. Dieser Prozess sollte mit führenden Vertreter*innen – 19 Ärzten, einer Ärztin, einem Juristen und zwei Verwaltungsspezialisten – abrechnen. Aber auf der Anklagebank saß symbolisch auch die „in großen Teilen willfährige deutsche Medizin“ (Eckart 2017: A1525), zumal „diese kleine Schar von Menschen niemals diese Unsumme von Leid“ (Mitscherlich/Mielke 1947: 12) hätte verwirklichen können. Und dennoch: Kaum einer der in Nürnberg lebenslang Verurteilten starb in Haft, es gab vorzeitige Entlassungen, beschämende Rehabilitationsversuche, Helfer und Helfershelfer blieben weitgehend unbehelligt (Forsbach 2015; Peter 2015). Die nie zuvor da gewesene „massive und vielfältige ärztliche Gewalttätigkeit“ (Bastian 2001: 9), die nicht wiedergutzumachenden Menschenrechtsverletzungen meinten fast alle Beschuldigten mit einem Befehlsnotstand erklären zu können.
Die Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekammern hatte eine Beobachtergruppe für den Nürnberger Ärzteprozess zusammengestellt: den Heidelberger Neurologen und Psychosomatiker Alexander Mitscherlich und den Medizinstudenten Fred Mielke. Dieser Auftrag wurde von allen medizinischen Fakultäten aller Besatzungszonen unterstützt, wenngleich dies auch an die Hoffnung geknüpft war, nicht die gesamte deutsche Ärzteschaft schuldig zu sprechen. Noch während des Prozesses publizierten Mitscherlich und Mielke die erste Dokumentation Das Diktat der Menschenverachtung; anderthalb Jahre später folgte die erweiterte Dokumentation Wissenschaft ohne Menschlichkeit, 1960 die Taschenbuchausgabe Medizin ohne Menschlichkeit. Die Reaktion auf diese Publikationen war nicht Trauer um die Opfer, sondern Ignoranz oder Empörung über die vermeintliche Nestbeschmutzung; herausragende Kolleg*innen galten als diffamiert. Lediglich die von Mitscherlich erwähnten 350 Ärzte, die Medizinverbrechen begangen hatten, wurden als schuldige Kolleg*innen akzeptiert. Mitscherlich ergänzte allerdings: Das treffe nicht den Kern des Problems! Denn Bewältigung der Schuld könne nichts anderes heißen, als der Wahrheit ins Auge zu sehen, und sei es nur das vermeintlich harmloseste Mitlaufen (Mitscherlich/Mielke 1978: 8, 13). Gegen die erste Dokumentation opponierten einige namentlich erwähnte Täter auf gerichtlichem Wege und erreichten tatsächlich einstweilige Verfügungen bzw. Vergleiche. Daraufhin wurde angeordnet, beanstandete Textstellen zu kommentieren, zu verändern oder zu löschen. Die zweite Dokumentation blieb vollkommen ohne Wirkung – „als sei das Buch nie erschienen“ (Mitscherlich/Mielke 1978: 8, 14–15). Weiteren Dokumentationen erging es ähnlich, etwa Die Tötung Geisteskranker in Deutschland von Alice von Platen-Hallermund oder die Selektion in der Heilanstalt von Gerhard Schmidt. Gründe dafür sind im historischen Kontext der Nachkriegszeit zu sehen, in dem nur eine deutsche Minderheit Betroffenheit und Scham über die NS-Verbrechen empfand, die überwiegende Mehrheit die Verbrechen jedoch kollektiv beschweigen oder abwehren wollte (Ebbinghaus/Dörner 2002; Peter 2015).
Scham, Mechanismen der Abwehr, öffentliche Sprachlosigkeit, fehlende Trauer für die Opfer und verdrängte Inhalte verhinderten jahrzehntelang eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Unter Mediziner*innen wurde dieses kollektive Verhalten von einem geradezu undurchdringbaren Standesbewusstsein begünstigt.
Kontinuitäten
Die ersten großen Prozesse vor alliierten Gerichten wurden gegen die NS-Führung geführt, was entlastend auf andere Mittäter*innen aus Verwaltung, Wehrmacht, Wirtschaft, Wissenschaft oder eben das Gesundheitswesen wirkte. Ab 1949 galten hochrangige Täter oft nur noch als „Gehilfen“. Wer bis dahin nicht als „sadistischer Intensivtäter“ eingestuft worden war, hatte im Prinzip nicht mehr viel zu befürchten (Jasch/Kaiser 2017).
Die politischen und rechtlichen Systeme der Bundesrepublik Deutschland und der DDR entwickelten sich weit auseinander. Dennoch verabschiedeten der Deutsche Bundestag und die DDR-Volkskammer fast zeitgleich Amnestiegesetze, die sich aber in quantitativer und qualitativer Hinsicht erheblich voneinander unterschieden. Obwohl der „staatsoffizielle Antifaschismus“ der DDR Abgrenzungsinstrument nach Westen und zugleich Herrschaftsmittel nach innen war (Münkler 2009), blieben Rehabilitierung und Wiedereingliederung im Wesentlichen auf nominelle NSDAP-Mitglieder beschränkt. In der Bundesrepublik hingegen konnten Mitläufer*innen und schwer Belastete in fast alle Positionen des öffentlichen Dienstes und der freien Wirtschaft einrücken (Weinke 2002: 334–336).
Mediziner*innen wurden in der Nachkriegszeit im Osten wie im Westen dringend gebraucht: für die medizinische Versorgung der Bevölkerung, die Gesundheitsverwaltung oder die universitäre Ausbildung. Aus dieser Notlage heraus konnten die mehr und die weniger verstrickten Mediziner*innen auch nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ weiterhin tätig sein. Für diese personellen Kontinuitäten verhalfen aber auch Seilschaften oder Netzwerke, das kollegiale Zusammenhalten der Ärzteschaft und nicht zuletzt auch die Gerichte, die allzu oft die Beweislage als nicht genügend beurteilten. An dieser Stelle seien vier Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt:
Der deutschnational und deutschvölkisch geprägte Karl Haedenkamp (1889–1955), von 1924 an ärztlicher Standespolitiker in leitender Funktion, war ab 1933 maßgeblich mit der Gleichschaltung im Gesundheitswesen sowie der Verfolgung politisch oppositioneller und jüdischer Kolleg*innen befasst. Er vermochte es nach 1945, sich als Widerstandskämpfer darzustellen: Dazu verhalfen einige „Persilscheine“ sowie die eigene Angabe, all seine Unterlagen seien im Krieg verloren gegangen. Er wurde rasch entnazifiziert. Dieser „Schreibtischtäter“ ist ein Beispiel für diejenigen Täter*innen, mit denen sich die Gerichte schwerer taten als beispielsweise mit dem Personal der Vernichtungslager. Haedenkamp hatte im ersten Nachkriegsjahrzehnt maßgeblichen Einfluss auf den Wiederaufbau der ärztlichen Berufsorganisation in Westdeutschland. Hohe Anerkennung zollte die Ärzteschaft ihm u. a. mit der Kölner Haedenkamp-Straße, in der sich die Bundesärztekammer sowie die Kassenärztliche Bundesvereinigung befanden. Den jahrelangen Kampf gegen eine Umbenennung mussten die ärztlichen Standespolitiker 1986 zähneknirschend aufgeben: Seitdem gibt es in Köln-Lindenthal die Herbert-Lewin-Straße, benannt nach einem bekannten Repräsentanten der Jüdischen Gemeinde, Gynäkologen und Holocaustüberlebenden (Schwoch 2016).
Personelle Kontinuitäten gab es auch bei Mediziner*innen, die an Menschenversuchen beteiligt waren: Der Internist und Professor an der Reichsuniversität Straßburg, Otto Bickenbach (1901–1971), hatte über die Pathologie und Therapie der Kampfstofferkrankungen geforscht. Im KZ Natzweiler-Struthof bot sich die Gelegenheit, eine von ihm entwickelte Substanz gegen das Giftgas Phosgen an Häftlingen auszuprobieren, an Sint*ezza, Rom*nja und Jüd*innen. Ihren Tod kalkulierte er in einigen seiner Versuche vorsätzlich ein. Mindestens 50 Menschen starben bei diesen Experimenten. Bickenbach stand zwar mehrfach vor Gericht und wurde auch zu langjährigen Strafen und zur Zwangsarbeit verurteilt, aber schon 1955 folgte ein Straferlass: Bickenbach war fortan ein freier Mann und eröffnete eine internistische Praxis im nordrhein-westfälischen Siegburg. Zu seiner Rehabilitierung beantragte Bickenbach ein berufsgerichtliches Verfahren: 1966 befand das Berufsgericht für Heilberufe in Köln, Bickenbach habe seine Berufspflichten nicht verletzt (Baumann 2010: 85–86; Schmaltz 2017: 521–562).
Wohlwollend urteilte die Justiz auch bei Ärzt*innen, die in die Krankenmorde verstrickt waren. Auf dem Jenaer Lehrstuhl für Kinderheilkunde wirkte seit 1917 Jussuf Ibrahim (1877–1953), der zugleich das dortige Kinderkrankenhaus leitete. Ibrahim überwies Kinder seiner Klinik in die „Kinderfachabteilung“ des Landeskrankenhauses Stadtroda und empfahl ausdrücklich „Euthanasie“. Für die auffällig hohe Letalität auf dieser Station – schätzungsweise 133 Kinder und Jugendliche starben dort – zwischen 1941 und 1945 war der Leiter Gerhard Kloos (1906–1988) verantwortlich. Im Jahre 1961, Kloos war bereits Direktor des Landeskrankenhauses Göttingen und Sachverständiger in Wiedergutmachungsverfahren, betonte er bei einer Vernehmung, dass es zu vorsätzlichen Tötungen in seiner Einrichtung nie gekommen sei. Das Verfahren wurde 1963 eingestellt. Kloos war sich seiner Sache sehr sicher, sodass er 1984 an Ernst Klee schrieb, in Stadtroda habe es nie eine „Kinderfachabteilung“ gegeben (Klee 2010: 505; Zimmermann 2000: 160ff.). Jussuf Ibrahim hingegen war ein Verfahren gänzlich erspart geblieben: Als hochdekorierter Arzt in der DDR (Ehrenbürger der Stadt Jena, Verdienter Arzt des Volkes, Nationalpreisträger der DDR I. Klasse für Wissenschaft und Technik) wurden die Universitätskinderklinik, Kindergärten und Straßen nach ihm benannt. Er genoss zeit seines Lebens höchste Anerkennung und wurde vor allem in Thüringen zum Inbegriff des humanistisch handelnden Arztes. Als Susanne Zimmermann den Zusammenhang zwischen Ibrahim und den NS-Kindermorden entdeckte, entzündete sich eine emotionale Debatte. Nach monatelangen, nach wie vor noch nicht völlig beendeten kontroversen Diskussionen wurde beschlossen, die Universitätskinderklinik, aber auch die Kindergärten sowie Straßen dürften den Namen Ibrahims nicht mehr tragen (Zimmermann 2000, 2006).
Schlussstrich-Mentalität
Über Jahrzehnte gab es im Nachkriegs-Deutschland einen erheblichen Widerstand dagegen, die deutschen Verbrechen zu thematisieren, Täter*innen zu benennen, die Mitverantwortung großer Teile der deutschen Bevölkerung anzuerkennen. So leicht es einst gewesen sei, so Aleida Assmann, den Angriffsgeist zu mobilisieren und das Bewusstsein für den Krieg zu schärfen, so schwierig sei es nach Kriegsende gewesen, ein Bewusstsein von „wir sind besiegt!“ zu verankern. Und schlimmer noch: Die so effektiv betriebene Mord-Maschinerie habe nicht nur Lebenszusammenhänge, sondern auch die menschlichen Formen des Trauerns, Erinnerns, Gedenkens tief greifend zerstört (Assmann 1999: 103–104). So wundert es nicht, dass sich diese Schlussstrich-Mentalität jahrzehntelang hielt, in beinahe allen politischen Parteien, in beinahe allen Gesellschaftsbereichen. Das gilt auch für die deutsche Ärzteschaft, in der es noch heute den „Reflex der Kollektivschuldabwehr“ gibt, selbst wenn man schlichte Fakten wie die NSDAP-Mitgliedschaft benennt (Forsbach 2015: 98). Die Mär, dass sich nur eine Minderheit der deutschen Ärzt*innen dem Nationalsozialismus zugewandt gehabt habe bzw. in nationalsozialistische Verbrechen verstrickt gewesen sei, hielt sich hartnäckig.
Innerhalb der ärztlichen Standesorganisationen wurde die Geschichte der NS-Medizin bis in die 1980er Jahre hinein – teilweise deutlich länger – ausgeblendet, abgewehrt oder banalisiert. Möglicherweise haben die nur wenigen gerichtlichen Verurteilungen und das ausgeprägte Standesbewusstsein der ärztlichen Kolleg*innen zu der Illusion geführt, dass nur ein geringer Teil der deutschen Ärzt*innen an den Verbrechen beteiligt gewesen sein konnte. Viele wollten ihre Nachkriegskarriere oder ungestörte ärztliche Tätigkeit auch nach dieser Katastrophe nicht verwirkt wissen. Die vielen personellen Kontinuitäten und offiziellen Reaktionen ärztlicher Standesvertreter*innen stützten diese Schlussstrich-Mentalität. Die Selbstverständlichkeit, dass im Vorstand der Bundesärztekammer ehemalige SA- und SS-Funktionäre agierten, sowie die Tatsache, dass der Deutsche Ärztetag des Jahres 1980 von Wilhelm Heim (1906–1997) – bis 1945 SA-Sanitäts-Standartenführer und seit 1983 Träger der Paracelsus-Medaille – eröffnet wurde, zeigt: Von einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Standesgeschichte konnte zu dieser Zeit noch keine Rede sein.
Auf dem richtigen Weg: vom Gesundheitstag 1980 bis heute
Parallel zum Deutschen Ärztetag 1980 fand eine Alternativveranstaltung statt: der Gesundheitstag. Der war aus dem Bedürfnis entstanden, eine Auseinandersetzung mit den ärztlichen Standespolitikern zu suchen. Es war klar, dass dieses Unternehmen „nach wie vor ein Wagnis“ darstellte, „das gelingen kann, wenn alle Teilnehmer, die sprechenden und die hörenden, die Skeptiker und die Zuversichtlichen, ihren Teil dazu beitragen und ihre Verantwortung ernst nehmen“ (Medizinisches Informations- und Kommunikationszentrum 1980). Über 12.000 Teilnehmende bildeten einen wirksamen Kontrast zur „verkrusteten Standespolitik“ (FrAktion Gesundheit o.J.). Noch im selben Jahr gaben Gerhard Baader und Ulrich Schultz ein grundlegendes Buch heraus, in dem sich die 19 Autor*innen mit der Ideologie des Sozialdarwinismus und seiner extremsten Ausformung, dem biologisch-rassisch fundierten völkischen Gedanken nebst den tödlichen Konsequenzen, genauso beschäftigten wie mit der Verquickung von Politik und Wissenschaft, der ärztlichen Standeslehre, der Arbeits- und Leistungsmedizin oder der Familien- und Bevölkerungspolitik (Baader/Schultz 1980).
Trotz dieses einschneidenden Gesundheitstages lehnte Bundesärztekammer-Präsident Karsten Vilmar noch auf dem Ärztetag 1987 eine „Kollektivschuld“ ab; schuldig sei vielmehr ein kleiner Kreis „radikaler Ärztekader“ sowie ein Clan von Ärzten mit „verbrecherischem Willen“ gewesen (Bleker/Schmiedebach 1987). Dennoch: Die Leistungen und Anstöße der ersten, die die Schlussstrich-Mentalität in der Ärzteschaft brechen wollten, waren nun nicht mehr aufzuhalten. Die Fülle der kritischen wissenschaftlichen Abhandlungen, die sich mit der Medizin im Nationalsozialismus auseinandersetzten, nahm in den 80er Jahren stark zu und ist heute nur mit Aufwand zu überblicken (Wuttke-Groneberg 1982; Jütte 2011). Die Pflege einer Aufarbeitungs- und Erinnerungskultur wird mittlerweile ebenso in zahlreichen anderen Aktivitäten und Einrichtungen geleistet – beispielsweise in Geschichtswerkstätten, Museen, Fernseh- und Radiodokumentationen, Arbeitskreisen und Gedenkveranstaltungen.
All dies zeigt, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Medizin im Nationalsozialismus eine nachhaltige Notwendigkeit ist, die allerdings nichts ungeschehen machen kann und auch für eine Wiedergutmachung oder Vergangenheitsbewältigung nicht taugt. Einen eingehenden und konstruktiven Diskurs über die NS-Medizin sollten Medizinstudierende und die Gesellschaft insgesamt führen, um dabei Unwissenheit und Tabuisierung durch Aufklärung und Erinnerung zu ersetzen. Damit könnte für die Gegenwart und Zukunft ein Beitrag geleistet werden, das Bewusstsein für eine Medizin in Verantwortung zu schärfen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.
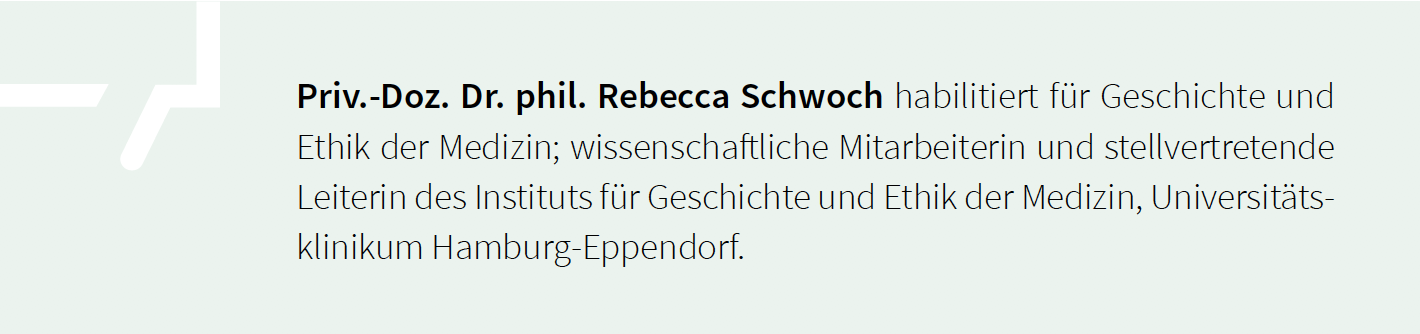
Literatur
Ash, Mitchel G. (2015): Ressourcenaustausche: Die KWG und MPG in politischen Umbruchzeiten – 1918, 1933, 1945, 1990. In: Hoffmann, Dieter/Kolboske, Birgit/Renn, Jürgen [Hrsg.]: „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen“. Auf dem Weg zu einer Geschichte der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft. Ed. Open Access: Berlin, S. 307–341.
Assmann, Aleida (1999): 1945 – Der blinde Fleck der deutschen Erinnerungsgeschichte. In: Assmann, Aleida/Frevert, Ute [Hrsg.]: Geschichtsvergessenheit, Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. DVA: Stuttgart, S. 97–139.
Baader, Gerhard (1999): Die Erforschung der Medizin im Nationalsozialismus als Fallbeispiel einer Kritischen Medizingeschichte. In: Bröer, Ralf [Hrsg.]: Eine Wissenschaft emanzipiert sich. Die Medizinhistoriographie von der Aufklärung bis zur Postmorderne. Centaurus-Verlagsgesellschaft: Pfaffenweiler, S. 113–120.
Baader, Gerhard/Schultz, Ulrich (1980) [Hrsg.]: Medizin und Nationalsozialismus: Tabuisierte Vergangenheit – Ungebrochene Tradition? Dokumentation des Gesundheitstages Berlin 1980, Bd. 1. Verlagsgesellschaft Gesundheit: Berlin.
Bastian, Till (2001): Furchtbare Ärzte: Medizinische Verbrechen im Dritten Reich. Verlag C.H.Beck: München.
Baumann, Stefanie M. (2010): Menschenversuche und Wiedergutmachung: Der lange Streit um Entschädigung und Anerkennung der Opfer nationalsozialistischer Humanexperimente. Oldenbourg Wissenschaftsverlag: München (Online-Ausg.).
Bleker, Johanna/Schmiedebach, Heinz-Peter (1987):
Sich der Wahrheit stellen. Medizinhistoriker kritisieren Dr. Vilmar. Online: www.zeit.de/1987/46/sich-der-wahrheit-stellen/komplettansicht? [04.03.2020].
Bock, Gisela (2010): Zwangssterilisation im Nationalsozialismus: Studien zur Rassenpolitik und Geschlechterpolitik. MV-Wissenschaft: Münster.
Ebbinghaus, Angelika/Dörner, Klaus [Hrsg.] (2002): Vernichten und Heilen: Der Nürnberger Ärzteprozess und seine Folgen. Aufbau Taschenbuch Verlag: Berlin.
Eckart, Wolfgang U. (2017):
Der Nürnberger Ärzteprozess. In: Deutsches Ärzteblatt 114, Heft 33–34, S. A1524–A1525. Online: www.aerzteblatt.de/pdf.asp [04.03.2020].
Forsbach, Ralf (2015): Die öffentliche Diskussion der NS-Medizinverbrechen in Deutschland seit 1945: Kollektivschuld, Vergangenheitsbewältigung, Moralismus. In: Braese, Stephan/Groß, Dominik [Hrsg.] (2015): NS-Medizin und Öffentlichkeit. Formen der Aufarbeitung nach 1945. Campus Verlag: Frankfurt/New York, S. 97–132.
FrAktion Gesundheit in der Ärztekammer Berlin: 1980–1986 Die Gesundheitsbewegung verändert das Gesundheitssystem.
Online: www.fraktiongesundheit.de/mitmachen/geschichte/19-menue-mitmachen/geschichte-der-fraktion/64-geschichte-1980-1986-die-gesundheitsbewegung [04.03.2020].
Fuchs, Petra/Rotzoll, Maike/Müller, Ulrich/Richter, Paul/Hohendorf, Gerrit [Hrsg.] (2007): „Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst“: Lebensgeschichten von Opfern der nationalsozialistischen „Euthanasie“. Wallstein: Göttingen.
Gruner, Wolf (2000): Armut und Verfolgung: Die Reichsvereinigung, die jüdische Bevölkerung und die antijüdische Politik im NS-Staat 1939 bis 1945. In: Jersch-Wenzel, Stefi/Guesnet, Francois/Pickhan, Gertrud/Reinke, Andreas/Schwara, Desanka [Hrsg.]: Juden und Armut in Mittel- und Osteuropa. Böhlau: Köln/Wien/Weimar, S. 405–433.
Jasch, Hans-Christian/Kaiser, Wolf (2017): Der Holocaust vor deutschen Gerichten: Amnestieren, Verdrängen, Bestrafen. Reclam: Ditzingen.
Jütte, Robert/Eckart, Wolfgang U./Schmuhl, Hans-Walter/Süß, Winfried (2011): Medizin und Nationalsozialismus: Bilanz und Perspektiven der Forschung. Wallstein-Verlag: Göttingen.
Kater, Michael H. (2000): Ärzte als Hitlers Helfer. Europa Verlag: Hamburg/Wien.
Klee, Ernst (2010): „Euthanasie“ im Dritten Reich: Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. vollst. überarb. Neuausgabe. Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt a. M.
Medizinisches Informations- und Kommunikationszentrum [Hrsg.] (1980): Gesundheitstag Berlin. Selbstverlag: Berlin.
Mitscherlich, Alexander/Mielke, Fred (1947): Das Diktat der Menschenverachtung. Verlag Lambert Schneider: Heidelberg.
Mitscherlich, Alexander/Mielke, Fred (1949): Wissenschaft ohne Menschlichkeit: Medizinische und eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg. Verlag Lambert Schneider: Heidelberg.
Mitscherlich, Alexander/Mielke, Fred (1978): Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses, Neuausgabe. Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt a. M.
Münkler, Herfried (2009): Antifaschismus als Gründungsmythos der DDR: Abgrenzungsinstrument nach Westen und Herrschaftsmittel nach innen. In: Konrad Adenauer Stiftung [Hrsg.]: Der Antifaschismus als Staatsdoktrin der DDR. St. Augustin/Berlin, S. 31–49.
Ohnhäuser, Tim/Westermann, Stefanie/Kühl, Richard (2010): Bilder ärztlichen Handelns im Nationalsozialismus: Eine Umfrage unter Medizinstudierenden. In: Dies. [Hrsg.]: Verfolger und Verfolgte. „Bilder“ ärztlichen Handelns im Nationalsozialismus. LIT: Münster, S. 261–282.
Peter, Jürgen (2015): Die von Alexander Mitscherlich, Fred Mielke und Alice von Platen-Hallermund vorgenommene Dokumentation des Nürnberger Ärzteprozesses. In: Braese, Stephan/Groß, Dominik [Hrsg.] (2015): NS-Medizin und Öffentlichkeit. Formen der Aufarbeitung nach 1945. Campus Verlag: Frankfurt/New York, S. 17–55.
Platen-Hallermund, Alice von (1948): Die Tötung Geisteskranker in Deutschland. Verlag der Frankfurter Hefte: Frankfurt a. M.
Riha, Ortrun (2013): Grundwissen Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin. 2. Auflage. Verlag Hans Huber: Bern.
Roelcke, Volker (2006): Humanexperimente während der Zeit des Nationalsozialismus. In: Forsbach, Ralf [Hrsg.]: Medizin im „Dritten Reich“. Humanexperimente, „Euthanasie“ und die Debatten der Gegenwart. LIT: Münster, S. 99–134.
Schmaltz, Florian (2017): Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus: Zur Kooperation von Kaiser-Wilhelm-Instituten, Militär und Industrie. 2. Auflage. Wallstein: Göttingen.
Schmidt, Gerhard (1983): Selektion in der Heilanstalt 1939–1945. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Schwoch, Rebecca (2001): Ärztliche Standespolitik im Nationalsozialismus: Julius Hadrich und Karl Haedenkamp als Beispiele. Matthiesen Verlag: Husum.
Schwoch, Rebecca (2016): Herbert Lewin. Arzt – Überlebender – Zentralratspräsident (= Jüdische Miniaturen, Bd. 186). Hentrich & Hentrich: Berlin.
Schwoch, Rebecca (2018): Jüdische Ärzte als Krankenbehandler in Berlin zwischen 1938 und 1945. Frankfurt a. M.: Mabuse-Verlag.
Stiehm, Markus (2002):
Wissenslücke bei Studenten: Ärzte-Verbrechen im 3. Reich. Online: m.thieme.de/viamedici/arzt-im-beruf-aerztliches-handeln-1561/a/medizin-im-nationalsozialismus-4545.htm [10.01.2020].
Tanner, Jakob (2007): Eugenik und Rassenhygiene in Wissenschaft und Politik seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert: Ein historischer Überblick. In: Zimmermann, Michael [Hrsg.]: Zwischen Erziehung und Vernichtung. Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung im Europa des 20. Jahrhunderts. Franz Steiner Verlag: Stuttgart, S. 109–121.
Weinke, Annette (2002): Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland: Vergangenheitsbewältigung 1949–1969 oder: Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg. Ferdinand Schöningh: Paderborn.
Wuttke-Groneberg, Walter (1982): Medizin im Nationalsozialismus: Ein Arbeitsbuch. 2. unveränderte Auflage. Schwäbische Verlagsgesellschaft: Wurmlingen.
Zimmermann, Susanne (2000): Die Medizinische Fakultät der Universität Jena während der Zeit des Nationalsozialismus. VWB: Berlin.
Zimmermann, Susanne (2006): „Euthanasie wäre durchaus zu rechtfertigen ...“ Der Jenaer Professor Ibrahim und die NS-Kindermorde. In: Forsbach, Ralf [Hrsg.]: Medizin im „Dritten Reich“. Humanexperimente, „Euthanasie“ und die Debatten der Gegenwart. LIT: Münster, S. 81–98.