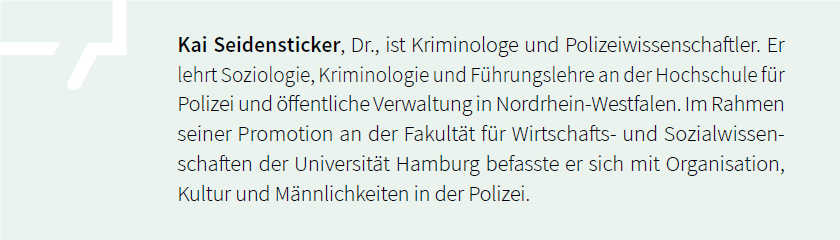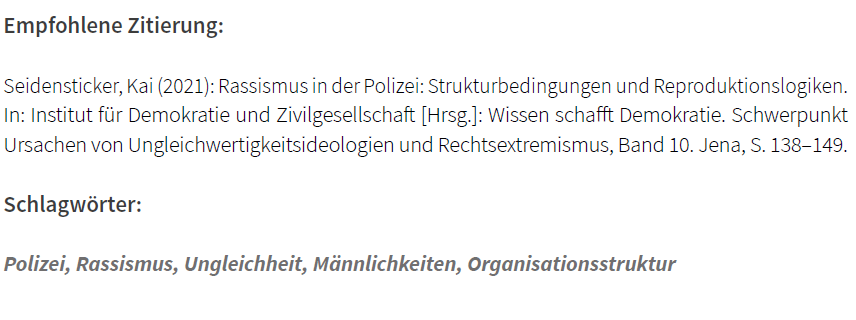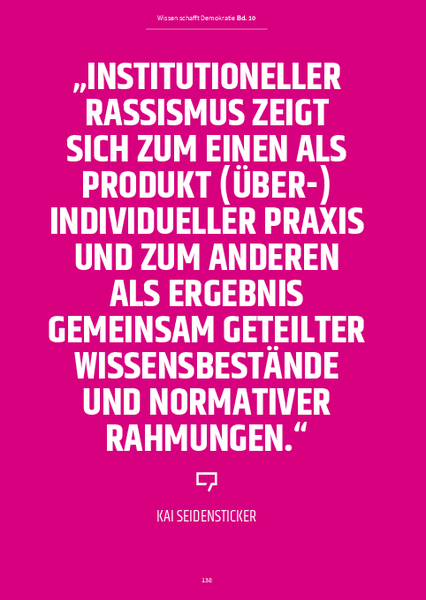Einleitung
In den zurückliegenden Jahren herrschte ein öffentliches Klima der Kritik und des Hinterfragens polizeilicher Praktiken, welches sich stark am Begriff des Rassismus innerhalb der Polizei orientierte. Nahezu täglich kam es zu neuen Meldungen über rassistisch motivierte Eingriffsmaßnahmen von Polizist*innen, neue Erkenntnisse zu rassistischen Chatgruppen innerhalb der Polizeien der Länder und des Bundes tauchten auf. In der Diskussion um Rassismus in der Polizei wird immer wieder das Spannungsfeld zwischen zwei Argumentationslinien sichtbar: Auf der einen Seite wird nicht von einem Polizeiproblem, sondern vielmehr von einem Problem mit einzelnen Polizist*innen in der Polizei ausgegangen, die eine ansonsten gut funktionierende Polizei verunglimpfen würden. Auf der anderen Seite wird von einem strukturellen oder institutionellen Problem der Polizei gesprochen, also auf das nicht leicht fassbare Phänomen abgestellt, dass das Handeln innerhalb der Polizei im Ergebnis auf eine Diskriminierung bestimmter Gruppen hinauslaufen kann, obwohl dieses nicht zwangsläufig individuell beabsichtigt ist. Hierbei wird der Blick auf Strukturen, Kulturen und erfahrungsbasierte Routinen gerichtet, welche die Grundlage für ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen sein können.
In diesem Beitrag wird Rassismus in der Polizei als institutionelle Praxis betrachtet und versucht, anhand eigener empirischer Erkenntnisse, Strukturbedingungen und Reproduktionslogiken rassistischer Praktiken herauszuarbeiten.
Rassismus in der Polizei
Rassismus ist kein exklusiv-polizeiliches, sondern ein gesamtgesellschaftliches und alltägliches Phänomen (vgl. Terkessidis 2010, 2004; Hall 1989) und damit nicht auf die Institution Polizei beschränkt. Häufig ist aber das Verständnis des Begriffs – bei Bürger*innen wie Polizist*innen – unklar. Rassismus wird zumeist als individuelles Phänomen verstanden und es erfolgt bisweilen eine Gleichsetzung mit Rechtsextremismus (z. B. GdP 2020). Diese Unschärfe trägt dazu bei, dass die Rassismusdebatte in der Polizei nicht konstruktiv geführt werden kann, sondern sich in einem Spannungsfeld aus individualisierter Schuldzuschreibung und -zurückweisung bewegt.
Verfolgt man die Diskussion um Rassismus in der Polizei, stößt man zwangsläufig auf zwei sehr präsente Argumentationslinien: Die erste Argumentation bewertet die öffentlich bekannt gewordenen Vorfälle von Rassismus als Einzelfälle und stellt damit auf die individuellen Einstellungen und das konkrete Tun, also den Rassismus als reflexive Praxis einzelner Personen ab. In dieser Argumentation finden rassistische Praktiken durch Polizist*innen statt, allerdings nur vereinzelt durch wenige „schwarze Schafe“ in einer sonst gut funktionierenden Polizei. Rassismus wird zum individuellen Fehlverhalten von Personen mit rassistischen Überzeugungen erklärt und grenzt diese Personen von der nicht-rassistischen Institution, aber auch von der Mehrheit der Polizist*innen ohne rassistische Überzeugungen ab. Vertreter*innen einer solchen Argumentationslinie finden sich zumeist in der Politik (BMI 2020) und in polizeilichen Interessenvertretungen (GdP 2020; ZEIT ONLINE 2020), aber auch in der Polizei selbst.
Verkannt wird in dieser Argumentation bereits die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen rassistischen Praktiken und den Strukturbedingungen der Institution – und somit die Möglichkeit, dass rassistische Praktiken auch von Polizist*innen vorgenommen werden können, die zunächst keine rassistischen Überzeugungen teilen. Durch diese Positionierung wird zum einen das Ziel verfolgt, das Bild der Polizei als hochmoralische Institution zu bewahren und damit die Legitimität polizeilichen Handelns zu festigen. Zum anderen reduziert diese Wahrnehmung die Komplexität des sozialen Phänomens Rassismus auf ein bearbeitbares Einzelfallproblem, bei welchem auf gängige Lösungsstrategien wie die Sanktionierung einzelner, individuell verantwortlicher Personen zurückgegriffen werden kann. Ein solcher Umgang mit rassistischen Praktiken in der Polizei bearbeitet das Problem jedoch nur vordergründig und ist, so scheint es angesichts der vielen ‚Einzelfälle‘ der letzten Jahre, für eine nachhaltige Lösung nicht geeignet.
In Anlehnung an die zweite Argumentationslinie erachte ich einen Blick auf Rassismus in der Polizei als gewinnbringend, bei dem – im Sinne einer kulturalistischen Rassismusperspektive – nicht nur individuelles Fehlverhalten von Polizist*innen betrachtet, sondern zusätzlich die Strukturen und Kulturen der Polizei in den Fokus genommen werden. Ich gehe davon aus, dass das Polizieren (hierunter kann im engeren Sinne das Tätigwerden der Polizei nach außen verstanden werden, beispielsweise durch Streifefahren, Vernehmungen oder Festnahmen) nicht nur als individuelle Praxis von einzelnen Polizist*innen, sondern (auch) als Ergebnis von Strukturen verstanden werden muss. Genauer gesagt verstehe ich Struktur und Praxis als rekursiv aufeinander bezogene Wirkmechanismen. So zeigt sich institutioneller Rassismus bspw. anhand kulturell verankerter Verdachtsschöpfungsstrategien zum einen als Produkt (über-)individueller Praxis und zum anderen als Ergebnis gemeinsam geteilter Wissensbestände und normativer Rahmungen. Institutioneller Rassismus kann verstanden werden als:
the collective failure of an organisation to provide an appropriate and professional service to people because of their colour, culture, or ethnic origin. It can be seen or detected in processes, attitudes and behaviour which amount to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness and racist stereotyping which disadvantage minority ethnic people. (Home Department 1999: 49)1
(Re-)Produktion von Ungleichheit
Obwohl mein Blick auf die Ordnungen der Polizei als Teil des DFG-geförderten Forschungsprojektes „Neujustierung von Männlichkeiten. Auswirkungen der Transformation von Erwerbsarbeit und des Wandels von Geschlechterverhältnissen auf männliche Lebenslagen“ auf Männlichkeitskonstruktionen gerichtet war, wurden im Material weitere Kategorien sichtbar, durch welche Ordnung in der Polizei strukturell hergestellt wird (Seidensticker 2021). Es wurde deutlich, dass Polizist*innen nicht frei von Einflüssen agieren, sondern als Akteur*innen des Feldes selbst in bestehende Arrangements von ‚Rasse‘, Klasse und Geschlecht eingebettet sind, verschiedene Kategorien sozialer Differenzierung zur Herstellung von Ungleichheit im Rahmen polizeilicher Praxis zusammenwirken und ineinander verschränkt sind. Vor diesem Hintergrund fordern bspw. Künkel (2014) oder Bruce-Jones (2015) eine intersektionale Perspektive auf das Polizieren einzunehmen, indem sie neben der Hautfarbe und vermuteten Herkunft der betroffenen Personen auch auf die Kategorien Geschlecht, Alter und Klassenzugehörigkeit als polizeiliche Selektionskriterien hinweisen. Auch Behr (2019: 39) verweist darauf, dass Zuschreibungen, bspw. „arm“ oder „wohnungslos“, in Verbindung mit dem spezifischen situativen Kontext zu einer Ungleichbehandlung durch die Polizei führen können.
Polizieren von Ungleichheit
Bereits zu Beginn der polizeilichen Laufbahn werden die Reproduktionslogiken sozialer Ungleichheit unter dem Deckmantel unhintergehbarer Wahrheiten des Polizierens von den Polizist*innen inkorporiert. Hier lernen diese, insbesondere in den von diensterfahrenen Polizisten angeleiteten Praxisabschnitten, durch die Überlieferungen vermeintlich praxiserprobter Handlungsstrategien einen zumeist auf tradierten Vorstellungen des Polizierens beruhenden Umgang mit den Bürger*innen. Diese Handlungsstrategien werden als Folie für „gute“ Polizeiarbeit inkorporiert und wirken auf die Praxis. So wird den Polizist*innen bspw. bereits in der Ausbildung, insbesondere im Umgang mit „muslimischen Mitbürgern und so“ vermittelt, „lieber mal mit dem Mann, am besten mit dem ältesten Mann, anstatt mit ner Frau“ zu reden (Seidensticker 2021: 299; vgl. hierzu auch Staller et al. 2019).
Die Herstellung von Differenz durch die (zugeschriebene) ‚andere‘ Kultur aufgrund (zugeschriebener) ethnischer Zugehörigkeit von Bürger*innen dient den Polizist*innen als Abgrenzung von der ‚eigenen‘ kulturellen Prägung. Funktional ist in diesem Sinne das Narrativ ausgeprägter patriarchaler Strukturen in als ‚fremd‘ wahrgenommenen Kulturen. Kulturelle Ungleichheit wirkt als Selbst-Versicherung der vermeintlichen Fortschrittlichkeit der Eigengruppe und geht mit einer Abwertung der Fremdgruppe einher. In den Denk-, Bewertungs- und Handlungsschemata der Polizist*innen wird dies durch die Zuordnung von Bürger*innen zu einer als ‚fremd‘ gerahmten Kultur sichtbar (Seidensticker 2021: 323). Zusätzlich erfolgt durch die Praxis des Polizierens solcher vermeintlich ‚anderer‘ kultureller Gruppen eine Legitimation tradierter Geschlechterverhältnisse, indem Männern generell die Herrschaft über Frauen zugesprochen wird und die als männlich gelesenen Bürger durch die Polizist*innen in der Folge auch so adressiert werden.
Zudem wird durch die erzeugte Differenz die eigene Polizeimännlichkeit von anderen Männlichkeiten abgegrenzt. Die damit einhergehende kulturelle Hierarchisierung führt zur Marginalisierung von Personen, die als Angehörige ‚anderer‘ Kulturen gelesen werden, macht die aggressive Polizeimännlichkeit im Umgang mit Bürger*innen relevant und reproduziert diese gleichzeitig als dominantes Konstrukt im Feld. Das so strukturierte Polizieren ‚fremder‘ Kulturen kann ein wechselseitiges Muster beabsichtigter Herstellungsversuche von (männlicher) Dominanz erzeugen und führt insbesondere aufseiten der Polizei zu einer Wahrnehmung von als ‚anders‘ gelesener Bürger*innen als Angehörige einer devianten Gruppe.
Die Überwindung von Ungleichheit ist nicht Bestandteil des Polizierens. Dies zeigt sich auch darin, dass das Polizieren eine Praxis zwischen ungleichen Machtpositionen ist, die stets neu hervorgebracht werden müssen. Die im Feld hegemoniale aggressive Polizeimännlichkeit verfügt über einen ungebrochenen Dominanzanspruch; nicht nur im Feld selbst, sondern auch gegenüber den Bürger*innen. Sie muss vor dem Hintergrund einer staatspolizeilichen Tradition und Prägung der Polizei verstanden werden und sieht die Bürger*innen als Herrschaftsunterworfene an. Ihre Praxis kann vordergründig zwar an Gleichbehandlung orientiert sein und dem Interessenausgleich zwischen unterschiedlichen Konfliktparteien dienen. Dieses Leitbild des Polizierens verschleiert allerdings die Ungleichheit erzeugenden Machtstrukturen, durch welche die Polizei in ihrer Praxis implizit die Funktion der Garantin bestehender Ungleichheitsverhältnisse einnimmt. Aufgrund der Anerkennung der aggressiven Polizeimännlichkeit als soziales Orientierungsmuster richten sich polizeiliche Handlungsstrategien häufig an der Reproduktion von Ungleichheit aus, was in der Relevantsetzung unterschiedlicher Kategorien sozialer Ungleichheit im Alltag des Polizierens sichtbar wird.
Die Wirkmacht dieser Strukturbedingungen des Polizierens zeigt sich in ihrem hegemonialen Status, insbesondere in der Anerkennung dieser Strukturen durch gemeinsam geteilte Werte und Normvorstellungen. Auch wenn viele Polizist*innen die aggressive Polizeimännlichkeit und die damit verbundenen Vorstellungen von Ungleichheit nicht bewusst und offensiv proklamieren, so müssen sie sich doch zumindest in Relation zu diesen positionieren, um innerhalb der Institution agieren zu können. Auf diese Weise wird die Ordnungsstruktur der Polizei reproduziert und die Polizei selbst trägt zum Erhalt bestehender (gesellschaftlicher) Ungleichheiten und Machtrelationen bei, ohne dass hierfür zwangsläufig individuelle Diskriminierungsabsichten der Polizist*innen existent sein müssen (vgl. Künkel 2014: 78f.).
Dass polizeiliche Praxis im Kontext der Erzeugung bzw. Stabilisierung sozialer Ungleichheit wirksam sein kann, deutet auch die Studie „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen“ der Ruhr-Universität Bochum an. 42 % aller im Rahmen der Studie befragten Personen mit Migrationshintergrund gaben an, dass sie sich durch eine polizeiliche Maßnahme diskriminiert fühlten, weitere 15 % bejahten dies teilweise. Von den befragten People of Color fühlten sich sogar 62 % diskriminiert, weitere 12 % zumindest teilweise (Abdul-Rahman et al. 2020: 25). Ungleichbehandlung durch polizeiliche Maßnahmen erfuhren die befragten Personen darüber hinaus zumeist nicht nur einmalig, sondern manchmal (41 %), oft (30 %) oder gar ständig (18 %) (ebd.: 27).
Die Polizei und die „Anderen“ – antagonistische Ordnungsstruktur
Die Abgrenzung von anderen Gruppen ist für die Polizei als in hohem Maße funktional zu betrachten. Die Anderen werden benötigt, um von den eigenen Vorstellungen abweichende Merkmale auf diese zu projizieren und so wünschenswerte Merkmale exklusiv der Eigengruppe zuzuschreiben. Durch diese Abgrenzung fällt es Polizist*innen bspw. leichter, die Gewaltanwendung gegen andere Gruppen als einer (vermeintlich) guten Sache dienenden Praxis wahrzunehmen: Sie ‚bekämpfen‘ das deviante Verhalten von Bürger*innen und tragen zur Stabilisierung von Ordnung bei. Dabei ist ihnen reflexiv nicht bewusst, dass die von ihnen (re-)produzierte Ordnung immer auch eine Ordnung aus einer hegemonialen Position innerhalb der Gesellschaft darstellt und eng verbunden ist mit sozialer Ungleichheit. Die damit einhergehende Deutungshoheit impliziert keine Gleichbehandlung aller Bürger*innen, wie dies insbesondere im Umgang mit marginalisierten Gruppen deutlich wird. Vielmehr zeigt sich ein (polizeiliches) Denken in starken Kontrasten und klaren Grenzen, welches sich zwischen den Polen „gut“ und „böse“ mit klaren dichotomen Zuschreibungen ereignet und starre Erwartungshaltungen produziert. Diese antagonistische Ordnungsstruktur befördert Tendenzen der Hierarchisierung von Beziehungen, z. B. der Subordination marginalisierter Gruppen, und somit ein staatspolizeiliches Auftreten und Verhalten der Polizist*innen.
An dieser Stelle werden rassifizierte und hierarchisierende Deutungsmuster der Polizei relevant, durch welche die Abgrenzung von anderen Gruppen erfolgt und der eigene Machtanspruch legitimiert wird (vgl. z. B. Mosler 2012; Opratko 2013). Einsatzsituationen werden auf ein komplexitätsbeschränkendes Deutungsmuster reduziert, welches in ‚gut‘ und ‚böse‘ differenziert und klare Zuschreibungen und Erwartungshaltungen produziert. Bürger*innen werden als „symbolic assailant“ (Skolnick 1966) konstruiert und mit rassifizierenden oder geschlechtsspezifischen Zuschreibungen aufgeladen. Dies trägt zu einer Überhöhung der Eigengruppe der Polizist*innen bei und verweist die Fremdgruppe auf die Position der Gefahrenverursacher*innen. Zuschreibungen äußern sich vor allem in Rassifizierungen, durch welche unterschiedliche soziale Gruppen konstruiert und die jeweiligen Zugehörigkeiten als natürliche Eigenschaften markiert werden (vgl. Opratko 2013: 322). Ein solcher Rückgriff auf die Handlungs- und Denkmuster einer staatspolizeilichen Identität ist gleichsam ein Rückgriff auf tradierte Männlichkeitsmuster und bereitet der aggressiven Polizeimännlichkeit die Bühne. Dies ist in hohem Maße funktional für den Umgang mit alltäglicher Kontingenz, genauer der grundsätzlichen situationsbezogenen Offenheit und Ungewissheit im Polizieren der Gesellschaft, indem die Polizei als moralische Instanz ihren Akteur*innen Handlungssicherheit durch Entscheidungsmacht und interne Legitimität verspricht.
Die Konstruktion dieser ‚Anderen‘ kann sich im Laufe der Zeit und in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten verändern. War es in den 1980er-Jahren noch die Gruppe der Student*innen, die von der Polizei als Störer*innengruppe konstruiert wurde, wird diese Funktion heute jungen, als migrantisch gelesenen Männern zugeschrieben (vgl. Behr 2021). Eine so erzeugte „Wir gegen Die“-Mentalität führt zur Herausbildung der antagonistischen Ordnungsstruktur der Polizei, welche stets aufs Neue relevant gemacht wird und an welcher die Praktiken der Polizist*innen ausgerichtet werden.
Polizieren als Praxis zwischen Dominanz und Gefahr
Polizieren zeigt sich als stark von einer prosozialen Form von Dominanz und der Konstruktion einer stets lauernden Gefahr der „Anderen“ geprägte Praxis, die sich aus der selbst auferlegten Schutzfunktion gegenüber den Kolleg*innen und den als schwach gelabelten Bürger*innen ergibt.
Dominanz ist ein integraler Bestandteil der aggressiven Polizeimännlichkeit und wird durch die notwendige Demonstration von Stärke erzeugt. Diese bestimmt zumeist den Umgang mit den Bürger*innen, bspw. in Form von Unnachgiebigkeit bei der beabsichtigten Zielerreichung, also der Durchsetzung einer Maßnahme. Die prosoziale Form von Dominanz wird symbolisch durch die Art des Auftretens artikuliert und muss fortlaufend durch den praktischen Einsatz des Körpers akkumuliert werden. Sie ist gegenüber den Bürger*innen funktional zur Sicherung von Legitimität, Durchsetzung von Macht und in der Konsequenz Herstellung von Ungleichheit.
Eine stets drohende Gefahr dient der Polizei insgesamt als in weiten Teilen diskursiv geprägtes Orientierungsmuster. Obwohl das direkte persönliche Gewalterleben nicht im Mittelpunkt der polizeilichen Tätigkeit steht, erfährt es innerhalb der Polizistenkultur hohe Relevanz. Insbesondere ein Zeit und Ort überdauerndes Sprechen über Gewalt bzw. die Möglichkeit von Gewalterfahrungen fördert die Vergemeinschaftung und Abgrenzung von der Außenwelt und trägt zudem dazu bei, einen diskursiv geprägten Rahmen für abweichendes Polizeihandeln zu erzeugen. Zudem wird das Merkmal der Gefährlichkeit auf den Raum und auch auf die Bürger*innen übertragen, mit denen die Polizist*innen tagtäglich interagieren. In dieser Rollenzuschreibung verbirgt sich ein weiterer Risikofaktor für die Herausbildung rassistischer Einstellungen, da
es vor allem die Polizei ist, die mit den Schattenseiten der Zuwanderung zu tun hat, also mit denjenigen Migranten, die kriminell werden. Es besteht die Gefahr, dass die Polizeibeamten solche Erfahrungen generalisieren. Das macht sie […] offener für vorurteilsbelastete fremdenfeindliche Positionen. (Jaschke 2018)
Gerade in der polizeilichen Raumabstraktion und -zuschreibung werden Gefahrengebiete konstruiert, in denen die Polizei ohne konkrete Verdachtsmomente Bürger*innen kontrollieren darf (Hunold/Wegner 2020). An diesen als problematisch wahrgenommenen Orten halten sich meist nicht nur rassifizierte Menschen vermehrt auf (Thompson 2018: 2), sondern ihnen wird aufgrund der räumlichen Zuordnung zum Gefahrenort das Merkmal der Gefährlichkeit zugeschrieben (Belina 2016).
Hunold (2015) konnte in ihrer empirischen Forschung zwar weder explizit rassistische Handlungen noch „ethnic profiling“ (ebd.: 213f.) beobachten, spricht aber von einer feststellbaren „sozialraumorientierte[n] Polizeipraxis“, die u. a. zu einer „über den Raum gesteuerte[n] Ungleichbehandlung ethnischer Minderheiten“ (ebd.: 217) führe. Diese Ungleichbehandlung ergibt sich aus der durch die Polizist*innen wahrgenommenen Zugehörigkeit von Bürger*innen zu bestimmten Räumen, wobei diese Zuordnung vor allem über äußere Merkmale erfolgt (ebd.: 218). Werden Wohngebiete mit hohem Migrationsanteil von der Polizei von vornherein als problematisch wahrgenommen, kann dies gerade dort anwesenden und als ‚migrantisch‘ gelesenen Bürger*innen auf individueller Ebene zugeschrieben werden. Eine ähnliche Praxis stellten auch Schweer und Strasser (2003: 241ff.) fest: In spezifischen Stadtteilen wurden (vermeintlich) ausländische Männer häufiger von der Polizei kontrolliert.
Fazit
Die Polizei zeigt sich als eine auf Ungleichheitsvorstellungen beruhende Institution, deren Ordnungsstruktur durch die Praxis der Polizist*innen reproduziert wird. Selbst wenn diese die Vorstellungen von sozialer Ungleichheit nicht offen teilen oder keine rassistischen und gewalttätigen Ansichten vertreten, sind sie nichtsdestotrotz (Re-)Produzent*innen dieser Ordnungsstruktur und der damit verbundenen Praxis. Deutlich wird dies nach außen bspw. in der unverhältnismäßig häufigen und eingriffsintensiven Überwachung marginalisierter Gemeinschaften. Innerhalb des Feldes lässt sich dies in den vermachteten Diskursen zeigen, in welchen bspw. die Verbreitung einer rassifizierenden Broschüre samt Handlungsempfehlungen zum Umgang mit „arabischen Familienclans“ nahezu kritiklos möglich wird (vgl. Bosch 2020: 172).
Die Vermittlung von Ungleichheit (re-)produzierenden polizeilichen Handlungsstrategien findet sich an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Polizei wieder, z. B. bereits in den Praxistrainings während des Berufseinstiegs, wo diese als unhintergehbare Wahrheiten an die Polizeianwärter*innen weitergegeben werden. Anhand dieser Ergebnisse wird deutlich, dass Rassismus in der Polizei kein auf Einzelfälle reduzierbares individuelles Fehlverhalten darstellt und in der Konsequenz auch in dieser Form nicht untersucht und bearbeitet werden kann. Vielmehr werden Strukturen des Polizierens deutlich, die sich wechselseitig aus tradierten männlichkeitszentrierten Routinen und Handlungsstrategien ergeben und deren fortwährende Reproduktion fördern. Diese Strukturen können rassistische Praktiken ermöglichen und fördern.
***********
1 „das kollektive Versagen einer Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft einen angemessenen und professionellen Service zu bieten. Es zeigt sich in Prozessen, Einstellungen und Verhaltensweisen, die auf eine Diskriminierung durch unbewusste Vorurteile, Ignoranz, Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypen hinauslaufen, die Menschen aus ethnischen Minderheiten benachteiligen“ (Übersetzung KS).
Literatur
Abdul-Rahman, Laila/Espín Grau, Hannah/Klaus, Luise/Singelnstein, Tobias
(2020): Rassismus und Diskriminierungserfahrung im Kontext polizeilicher Gewaltausübung. Zweiter Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen“. Online: kviapol.rub.de [12.05.2021].
Behr, Rafael (2019): Verdacht und Vorurteil. Die polizeiliche Konstruktion der „gefährlichen Fremden“. In: Howe, Christian/Ostermeier, Lars [Hrsg.]: Polizei und Gesellschaft. Transdisziplinäre Perspektiven zu Methoden, Theorie und Empirie reflexiver Polizeiforschung. Springer VS: Wiesbaden, S. 17–45.
Behr, Rafael (2021): „Polizisten brauchen eine Antirassismushaltung“. In: Frankfurter Rundschau, D3.
Belina, Bernd (2016): Der Alltag der Anderen: Racial Profiling in Deutschland? In Döllinger, Bernd/Schmidt-Semisch, Henning [Hrsg.]: Sicherer Alltag? Politiken und Mechanismen der Sicherheitskonstruktion. Springer VS: Wiesbaden, S. 125–146.
Bosch, Alexander (2020): Die aktuelle Debatte um Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei. In: vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, 231/232, 59(3–4), S. 167–177.
Bruce-Jones, Eddie (2015): German policing at the intersection: race, gender, migrant status and mental health. In: Race & Class, 56, Heft 3, S. 36–49.
Bundesministerium des Innern [BMI]
(2020): „Jeder bewiesene Fall ist eine Schande. Jeder bewiesene Fall ist ein Fall zu viel!“. Online: www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2020/10/lagebericht-rechtsextremismus.html;jsessionid=9B7DB86C2E264E9D5F47B45E1C78186A.1_cid295 [12.05.2021].
Deutscher Bundestag (2015): Ausarbeitung Verdachtsunabhängige Maßnahmen nach § 22 Abs. 1a BPolG und „Racial Profiling“. Berlin.
ECRI
(2017[2003]): Allgemeine Politik-Empfehlung Nr. 7 von ECRI über Nationale Gesetzgebung zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung. Online: rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/16808b5aac [07.05.2021].
Gewerkschaft der Polizei [GdP]
(2020): Halt geben – Haltung stärken. Online: www.gdp.de/gdp/gdpsac.nsf/id/DE_Halt-geben-Haltung-staerken [12.05.2021].
Gilroy, Paul (2004): After Empire. Routledge: London.
Hall, Stewart (1989): Rassismus als ideologischer Diskurs. In: Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften, Heft 178, S. 913–922.
Home Department
(1999): The Stephen Lawrence Inquiry. London. Online: assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277111/4262.pdf [12.05.2021].
Hunold, Daniela (2015): Polizei im Revier. Polizeiliche Handlungspraxis gegenüber Jugendlichen in der multiethnischen Stadt. Duncker & Humblot: Berlin.
Hunold, Daniela/Wegner, Maren
(2020): Rassismus und Polizei: Zum Stand der Forschung. Online: www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/316766/rassismus-und-polizei-zum-stand-der-forschung [12.05.2021].
Jaschke, Hans-Gerd
(2018): "Die Fehlerkultur bei der Polizei ist zu schwach ausgeprägt". Online: www.tagesspiegel.de/22978484.html [12.05.2021].
Künkel, Jenny (2014): Intersektionalität, Machtanalyse, Theorienpluralität. Eine Replik zur Debatte um kritische Polizeiforschung. In: sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, 2, Heft 2, S. 77–90.
Lutz, Helma/Herrera Vivar, Maria Teresa/Supik, Linda (2010): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzeptes. Springer VS: Wiesbaden.
Mosler, Volkhard (2012): Rassismus im Wandel. Vom Sozialdarwinismus zum Kampf der Kulturen. In: theorie21, Heft 1, S. 19–52.
Opratko, Benjamin (2013): Zu Theorie, Geschichte und Funktion des Rassismus. In: theorie21, Heft 1, S. 319–330.
Rommelspacher, Birgit (2011): Was ist eigentlich Rassismus? In: Melter, Claus/Mecheril, Paul [Hrsg.]: Rassismuskritik. Band 1: Rassismustheorie und -forschung, 2. Ausg., Wochenschau Verlag: Schwalbach/Ts., S. 25–38.
Schweer, Thomas/Strasser, Hermann (2003): Die Polizei – dein Freund und Helfer?! In: Groenemeyer, Axel/Mansel, Jürgen [Hrsg.]: Die Ethnisierung von Alltagskonflikten. Springer VS: Wiesbaden, S. 229–260.
Skolnick, Jerome (1966): Justice without Trial: Law Enforcement in Democratic Society. John Wiley & Sons: New York.
Terkessidis, Mark (2004): Die Banalität des Rassismus: Migranten zweier Generationen entwickeln eine neue Perspektive. Transcript Verlag: Bielefeld.
Terkessidis, Mark (2010): Interkultur. Suhrkamp: Berlin.
Thompson, Vanessa
(2018): Racial Profiling im Visier. Rassismus bei der Polizei, Folgen und Interventionsmöglichkeiten. Online: www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2020/12/expertise_racial_profiling_vielfalt_mediathek_1.pdf [12.05.2021].
ZEIT ONLINE
(2020): Rassismusdebatte. Polizei wehrt sich gegen Rassismus-Vorwurf. Online: www.zeit.de/gesellschaft/2020-06/rassismusdebatte-deutschland-polizei-vorwurf-paul-ziemiak-rainer-wendt-antidiskriminierungsgesetz [12.05.2021].