Es ist äußerst wichtig anzuerkennen: Die negativen Auswirkungen von Hasskriminalität beschränken sich nicht nur auf Personen, die tatsächlich angegriffen werden. Sowohl die Nachricht über den Angriff als auch der hervorgerufene Schaden betreffen die gesamte soziale Gruppe bzw. Community der Betroffenen. So soll beispielsweise die Zerstörung des Eigentums einer jüdischen Familie die Botschaft an alle jüdischen Menschen senden, dass sie in der entsprechenden Nachbarschaft nicht willkommen sind. Weinstein (1992) hat dies als den Einschüchterungseffekt (in terrorem effect) von Hasskriminalität bezeichnet: eine durch die Täter_innen anvisierte Einschüchterung einer ganzen Community durch die Viktimisierung eines oder einiger Mitglieder dieser Gruppe. Den direkten Auswirkungen von vorurteilsmotivierter Gewalt auf primär Betroffene wurde bereits große Aufmerksamkeit geschenkt.
Kaum untersucht ist dagegen, wie sich diese Gewalt auf die indirekt Betroffenen auswirkt – also auf andere Menschen, die die Identität der Betroffenen teilen und somit zur selben Community gehören. Bisher wurde auch wenig erforscht, wie sich Hasskriminalität auf allgemeinere nationale Werte auswirkt. Angesichts des oft zitierten Befundes, dass die negativen Auswirkungen von Hasskriminalität umfassender sind als die von „normaler“, d. h. nicht vorurteilsgeleiteter Kriminalität, ist es unverständlich, dass es bisher keine Versuche gab, diese Fragen zu prüfen. Doch es ist unerlässlich, die breiteren sozialen Auswirkungen von Hasskriminalität sowohl theoretisch als auch empirisch genauer zu untersuchen. Aber wie können die Auswirkungen von Hasskriminalität auf die breite Öffentlichkeit gemessen werden? Wie wirkt sie sich auf die Wahrnehmung der bürgerlichen Freiheiten aus, die in demokratischen Staaten als wichtig angesehen werden? Inwieweit spiegeln spezifische Vorfälle von Hasskriminalität einen allgemeineren Hass innerhalb der Gesellschaft wider? Inwieweit wird dieser durch Hasskriminalität verschärft oder gemildert? Jede Kombination dieser Fragen bietet uns wertvolle Ausgangspunkte, um weit verbreitete Annahmen über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen von Gewalt gegen Minderheiten zu überprüfen.
Im Folgenden skizziere ich einige qualitative Befunde einer Umfrage sowie von Befragungen von Fokusgruppen2. Interviewt wurden Mitglieder von sieben „gefährdeten Communitys“, die die Ontario Hate Crime Community Working Group (2006) identifiziert hat: indigene Völker; Afrokanadier_innen; Asiat_innen; Menschen jüdischen Glaubens; Menschen muslimischen Glaubens; Südasiat_innen; Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle/Transgender. Ziel der Studie war es herauszufinden, inwieweit Hasskriminalität tatsächlich eine Botschaft an die Mitglieder der gesamten sozialen Gruppe der Betroffenen darstellt und wie sich diese Nachricht der Gewalt auf die indirekt oder stellvertretend Betroffenen auswirkt.
Die Ergebnisse deuten darauf hin: Das Bewusstsein für die Gewalt ruft auffallend ähnliche Muster emotionaler und verhaltensbezogener Reaktionen unter den indirekt bzw. stellvertretend Betroffenen hervor. Sie zeigen, obwohl sie nicht direkt selbst betroffen sind, ein komplexes Reaktionssyndrom, das Schock, Wut, Angst, Verwundbarkeit, Minderwertigkeitsgefühle und ein Gefühl für die Normativität dieser Art von Gewalt einschließt. Wie bei den direkt Betroffenen führt Hasskriminalität bei den indirekt Betroffenen oft zu Verhaltensänderungen, etwa zu veränderten Mustern sozialer Interaktion. Positiv ist zu vermerken: Es gibt Hinweise, dass diese Reaktionen nicht nur zu Rückzug führen können, sondern potenziell auch zu einer gemeinsamen Mobilisierung aufseiten der Betroffenen.
Auswirkungen auf die Community
Einschüchterungseffekte
Schock
Häufig geäußert wurde ein Gefühl des Schocks darüber, dass Hasskriminalität in unserem Zeitalter und in unserer Gemeinschaft immer noch fortbesteht: „Ich war schockiert und enttäuscht, weil ich gedacht hätte, dass unsere Gesellschaft schon weiter entwickelt ist.″ Deutlich wird die Fassungslosigkeit der Befragten darüber, dass Menschen in dieser vermeintlich „freundlicheren, sanfteren″ Nation (gemeint ist Kanada, Anmerkung des Übersetzers) weiterhin Hassverbrechen ausüben. Nach dem kanadischen Selbstbild ist Kanada eine harmonische, multikulturelle Gesellschaft. Die Realität der Hasskriminalität ist daher besonders für Neuankömmlinge oft erschütternd, denn sie sind nicht selten wegen der Suche nach oder zumindest in Erwartung eines einladenden gesellschaftlichen Klimas hierher gezogen. Ein südasiatischer Teilnehmer äußerte seine Bestürzung: „Der Schmerz ist stark, denn in Kanada sollten wir eigentlich in einer Gesellschaft ohne Angst vor Angriffen leben. Das hätte ich hier nie erwartet.“ Ein schwuler Befragter berichtete: „Ich war kürzlich bei einer Versammlung der LGBT3-Community , wo ich von einer Trans-Person hörte, die in der Region Durham körperlich angegriffen worden war. Ich war schockiert und enttäuscht.“ Es lässt sich konstatieren: Das Bewusstsein für Hasskriminalität zerstört die Erwartungen von Harmonie, Gemeinschaft und Integration.
Das Fortbestehen von Hasskriminalität widerspricht den tief verwurzelten Idealen des Multikulturalismus grundsätzlich. Ein jüdischer Teilnehmer benannte diese Inkonsistenz: „Trotz einer scheinbar wachsenden Toleranz würde mich (Hasskriminalität) nicht im geringsten überraschen.“ Es besteht also ein starker Widerspruch zwischen der wahrgenommenen Normativität der Hasskriminalität und der Überraschung, wenn sie auftritt. Dies ist vielleicht ein Ausdruck für den Wunsch der Befragten, ihre jeweiligen Weltanschauungen beizubehalten, wie Noelle (2002) ausführt. Sie argumentiert, Verleugnung sei ein Mittel potenzieller Opfer, um kognitive Dissonanz und Angst zu managen. Dafür gibt es tatsächlich einige Belege im Sinne von: ‚Nein, nicht hier; nicht in Kanada; das kann nicht sein!‘ Wichtig ist: Das Unvermögen, nachzuvollziehen, dass Hasskriminalität auch im vermeintlich liberalen und offenen Kananda eine gesellschaftliche Realität ist, kann das damit verbundene Trauma verschlimmern.
Wut
Als weitere Folge drückten viele Befragte Wut aus. Reaktionen wie „empört“, „wütend“, „angewidert“, „verärgert“ und „zornig“ waren üblich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die direkt von Hasskriminalität Betroffenen solche Gefühle zum Ausdruck bringen. Verschiedene Studien haben mittlerweile spezifische und generalisierte Wut als Folge der Opferwerdung festgestellt – sowohl gegenüber den Täter_innen als auch gegenüber einer Kultur der Vorurteile und Ausgrenzung (Craig-Henderson 2009, Herek et al. 2002, McDevitt et al. 2001). Es ist nicht verwunderlich, dass sich nicht viktimisierte Angehörige gefährdeter Communitys ebenfalls über Hasskriminalität empören. Ein schwuler Mann berichtete von seiner Reaktion nach einem brutalen Angriff auf eine lesbische Person:
"Ich war in einem Club in Toronto und als wir gingen, war auf dem Parkplatz eine bewusstlose Frau, die von ein paar Männern verprügelt worden war. Ich war schockiert und erschrocken. Ich fühle mich immer noch angewidert und kann mir kaum vorstellen, dass zwei Männer eine Frau verprügeln und sich vor sich selbst dafür rechtfertigen können. Es ist widerlich und es macht mich wütend."
Dieses Beispiel illustriert einen Fall von Wut, der weitgehend auf die Täter ausgerichtet ist. Ein anderer Teilnehmer – ein Schwarzer Mann – drückte seine Wut über eine die Hasskriminalität bestärkende Kultur aus: „Ich bin angewidert darüber, dass unsere Gesellschaft heute noch rassistische Gewalt fördert und zulässt. Wann wird es aufhören?“ Dies deutet auch darauf hin: Angehörige gefährdeter Communitys sind sich schmerzlich bewusst, dass Hasskriminalität in einem gesellschaftlichen Klima von Intoleranz und Feindseligkeit entsteht.
Angst/Verletzlichkeit
Das Bewusstsein für das Potenzial von Hasskriminalität in betroffenen Communitys erhöht Gefühle von Verletzlichkeit und Angst. Das ist auch das Ziel der Hasskriminalität – das Hervorrufen von Angst und Einschüchterung in der gesamten Community, nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen. Interessanterweise haben viele Teilnehmende diesen Aspekt der Botschaft durch Hasskriminalität (message crimes) ausdrücklich benannt, als sie gebeten wurden, Hasskriminalität zu definieren:
"‚Hasskriminalität‘ ist eine Handlung, die Personen- oder Sachschäden mit der Absicht verursacht, eine Person aufgrund ihrer religiösen oder sexuellen Überzeugungen einzuschüchtern. Es soll eine Botschaft der Intoleranz gegen die ‚ausgewählte‘ Gruppe senden und ein Gefühl der Angst hinterlassen. Es soll auch eine Botschaft gesendet werden, dass die Zielpersonen aufgrund ihres Glaubens nicht sicher sind." (Frau muslimischen Glaubens)
Viele Mitglieder entsprechender Communitys empfangen die Botschaft klar und deutlich. Sie empfinden sich als ebenfalls anfällig für derartige Viktimisierung und sind deshalb ängstlich. Nach dem Lesen eines Szenarios, das ein hypothetisches Hassverbrechen beschreibt, bemerkte ein asiatischer Mann: „Ich fühle mit Jim – um seine Sicherheit und sein Wohlergehen. Ich denke auch, dass […] wir alle verwundbar sind.“ Das Beispiel zeigt eines der Hauptmerkmale von Hasskriminalität auf, das sie so erschreckend macht: ihre scheinbare Zufälligkeit. Wie viele Wissenschaftler_innen aus der Hate-Crime-Forschung festgestellt haben, sind die individuell Betroffenen oft austauschbar (Lim 2009; Levin/McDevitt 1998). Das gewählte Opfer repräsentiert einfach das Andere in allgemeiner Form. Dass er oder sie ein Mitglied der verhassten oder dämonisierten Gruppe ist, reicht aus, um sie oder ihn potenziell angreifbar zu machen. Und das heißt auch: Jedem Mitglied einer entsprechenden Zielgruppe kann es jederzeit und überall passieren.
Minderwertigkeit
Hasskriminalität und ihre einschüchternden (in terrorem) Auswirkungen können in den betroffenen Gemeinschaften Gefühle der Minderwertigkeit oder Unterdrückung verstärken. Tatsächlich argumentiere ich bereits seit einiger Zeit, dass das eigentliche Ziel von Hasskriminalität darin besteht, die gesellschaftliche Unterordnung der Betroffenen und ihrer Communitys wiederherzustellen.
In meinem Buch „In the name of Hate“ (Perry 2001) argumentiere ich: Die Täter_innen versuchen durch ihre vorurteilsmotivierte Gewalt, ihre dominante Identität, ihren Zugang zu Ressourcen und Privilegien zu bekräftigen. Zugleich versuchen sie, die Möglichkeiten der Betroffenen einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern. Die Ausübung von Hassgewalt bestätigt dann das vermeintlich „natürliche“ soziale Gefüge von Überlegenheit und Minderwertigkeit (Perry 2001). Hasskriminalität ist demnach eine Form des zwischenmenschlichen und interkulturellen Ausdrucks, der gesellschaftliche Grenzen definiert. Die beabsichtigte Botschaft können Angehörige gefährdeter Communitys erkennen.
Noch wichtiger ist: Hasskriminalität lässt sie ihre Stellung in der Gesellschaft tatsächlich hinterfragen. Sie fühlen sich „weniger würdig“ als die Täter_innen:
"Ob sie mich direkt oder indirekt betroffen hat – es war meines Erachtens nach Hasskriminalität, da ich mich dadurch schlechter als eine andere Person fühlte, weil es Angriffe auf mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein waren." (Lesbische Frau)
Auch dies ist bei unmittelbar von Hasskriminalität Betroffenen relativ häufig. Die Tatsache, dass es sich immer auch um ein stellvertretendes Opfer handelt, spricht für die Macht solcher vorurteilsmotivierter Gewalt, ganze Communitys einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.
Normativität
Die oben erwähnten Einschüchterungseffekte bekräftigen die weit verbreitete Auffassung, dass Hasskriminalität – und die damit verbundene Stigmatisierung und Marginalisierung – normativ ist. Dies ist ein Befund aus meiner Untersuchung kanadischer Ureinwohner_innen (Perry 2008). Besonders auffällig war in der älteren Studie die empirische Bestätigung der konzeptuellen Beobachtung, dass kanadische Ureinwohner_innen mit dem „täglichen Wissen leben [...] dass sie allein aufgrund ihrer Gruppenidentität der Gefahr von Angriffen ausgesetzt sind“ (Young 1995: 83). Über Staats- und Stammesgrenzen hinweg ließ sich konstatieren: Rassistische Gewalt und Belästigung sind normative Bestandteile der alltäglichen Erfahrung amerikanischer Ureinwohner_innen. Von den mehr als 270 amerikanischen Ureinwohner_innen, die in meiner Studie befragt wurden, war die Mehrheit entweder selbst betroffen von Hasskriminalität oder wusste von eine_r nahestehenden Betroffenen. Gewalt durchdringt das Leben der amerikanischen Ureinwohner_innen. Das zeigt sich auch darin, dass die meisten im Laufe ihres Lebens über mehrere Viktimisierungen berichteten. Selten beschrieben sie gewalttätige Viktimisierung als einmalig.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass ähnliche Muster auch die Erfahrungen anderer Gruppen von Betroffenen charakterisieren. In der Tat zeigen Studien über schwulenfeindliche Gewalt: Auch die Viktimisierung von Homosexuellen ist eher seriell als einmalig (Herek et al. 2002, McDevitt et al. 2001). Meine Studie mit den Ureinwohner_innen belegt: Sowohl direkte als auch indirekte Viktimisierungen sind wiederkehrend, da die meisten entweder persönliche Geschichten oder die von Freund_innen und Familienangehörigen mitteilen konnten. Zum Beispiel: „Es passiert viel, ich weiß. Es ist mir und den meisten meiner Freunde passiert. Es ist nicht immer sicher, wenn man sich geoutet hat.“ (Lesbische Frau)
Die Übereinstimmung in den individuellen und kollektiven Biografien und Geschichten über die Betroffenheit durch vorurteilsmotivierte Gewalt problematisiert Hasskriminalität einerseits und macht sie gleichzeitig auch normativ: „Es ist meinen Eltern passiert und es passiert mir immer noch. Es wird sich nicht ändern. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, die Menschen wie mich immer hassen wird. Deshalb passieren Hassverbrechen.“ (Schwarze Frau) Die Wahrnehmung der Unabänderlichkeit ist ermächtigend für Täter_innen und entmachtet potenziell Betroffene. Die allgemeine Akzeptanz der Permanenz von Rassismus ist beunruhigend fatalistisch. Diese Sicht auf Rassismus und Belästigung ist vor allem deshalb beunruhigend, weil sie die oben beschriebene Gewissheit der Gefahr alltäglicher Gewalt beinhaltet. Rassistische Gewalt wird in vielen gefährdeten Communitys als wesentlicher Teil des Lebens erwartet und akzeptiert.
Verhaltensänderungen
Angesichts der Normativität angstauslösender Gewalt lernen Angehörige gefährdeter Communitys, sich stärker um ihre Sicherheit zu kümmern (Mason 2009). Sie wenden eine Reihe von Strategien an, um ihre Gefährdung zu verringern, oft durch Änderungen von Verhaltensmustern (sich ändernde Routineaktivitäten, Gewohnheiten und Arten, unterwegs zu sein). Die Teilnehmenden berichteten, dass sie das Ausleben ihrer Identität anpassen an wahrgenommene sozial etablierte Regeln. „Selbst wenn du wegrennst, jagen sie immer noch hinter dir her. Ich wusste dann, dass ich in Grüppchen mit Freunden unterwegs sein musste. Geh nie alleine raus, bring Verstärkung mit, Zeugen und Handy.“ (Schwuler Mann)
Das Potenzial vorurteilsmotivierter Gewalt liegt somit darin, zumindest in der Öffentlichkeit vermeintlich „angemessenes“ Verhalten durchzusetzen. Für einige schränkt die Bedrohung durch Hassgewalt den Bewegungsradius und wahrgenommene Teilhabemöglichkeiten ein. Das führt zu gesellschaftlichem Rückzug. Ein südasiatischer Mann äußerte angesichts möglicher Gewalt: „Ich werde bestimmte Gebiete meiden. Ich werde meine Wege ändern. Ich versuche, wachsam zu sein und ich renne weg, bevor ich angegriffen werde.“ Auf diese Weise werden People of Color, Schwule, Lesben und andere, die vermeintlich minderwertig sind, auf ‚ihren Platz‘ verwiesen. Angesichts des Potenzials der ausgrenzenden Gewalt ist dies zwar keine freiwillige Wahl, aber es ist die ‚sicherere‘ Wahl – anstatt die Gefahr zu riskieren, gewaltsam von öffentlichen Plätzen vertrieben zu werden, entscheiden sich viele Betroffene und potenziell Betroffene, sich in ‚ihre eigenen‘ Geschäfte, Bars, Restaurants, ja sogar an entsprechende ‚eigene‘ Arbeitsplätze zurückzuziehen. Vorurteilsmotivierte Gewalt verstärkt die sozialen und geografischen Grenzen, die betroffene Minderheiten nicht überschreiten dürfen. Diese gewaltsamen Erfahrungen tragen zu anhaltendem Rückzug und Isolation bei. Kurz gesagt: Rassistische Gewalt fördert historische Segregationsmuster. Nirgendwo waren diese Auswirkungen auf das eigene Verhalten stärker als innerhalb der LGBTQ und muslimischer Communitys. Ein schwuler Mann gab zu: „Ich habe versucht, ‚weniger schwul‘ auszusehen.“ Solche Kommentare zeigen das Ausmaß der Hasskriminalität: Die Angst vor Gewalt führt bei (potenziell) Betroffenen zu einer vorsichtigen Konstruktion der eigenen Identität, um weniger sichtbar und angreifbar zu sein. Eine lesbische Frau berichtet:
"Es ist schade, dass es so ist, denke ich. Für mich, obwohl ich mir dessen nicht bewusst bin, also ich treffe diese Entscheidungen nicht bewusst, ich denke, es ist eher etwas wie ein Überlebensmechanismus. Ich nehme an, wenn man erwachsen wird und erkennt, dass man schwul oder lesbisch ist, fängt man an, es auf verschiedene Arten zu verbergen. Und obwohl ich es immer noch auf viele Arten verberge, und obwohl ich mich geoutet habe, verberge ich es immer noch in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube nicht, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe. Ich denke nur, dass es einfacher ist, oder? Für mich, wenn ich das höre, bin ich wütend und verletzt, und, ähm ... du weißt, dass du dir selbst sagst, nun, es hätte ich sein können (die angegriffen wurde, Anmerkung des Übersetzers), weißt du. Ich hatte mein Coming-out und viele Leute wissen davon und wenn jemand irgendwann mal wollte ... könnten diese Dinge auch mir leicht passieren. Aber, ja, es ist mehr wie, irgendwie wie, es macht dich ein wenig emotional fertig, als ob ich vielleicht mehr verbergen sollte. Ich bin mir sicher, dass sich auch das unbewusst in meinem Kopf abspielt. Nicht so offen zu sein, wenn du weißt, dass eine Bedrohung da ist."
Die Aussage zeigt anschaulich die scheinbar unauflösbare Verbindung zwischen der Bedrohung durch Gewalt und dem Ausleben von Sexualität. Deutlich wird daran, wie viele Mitglieder der LGBT-Community ihr Verhalten und die Art und Weise, sich auszudrücken, anpassen, um ihre sexuelle Orientierung zu verbergen und so die Möglichkeit der Viktimisierung zu verringern. Sowohl frühere Untersuchungen zu den Auswirkungen von Anti-LGBT-Hasskriminalität auf direkt Betroffene als auch Noelles Studie zum „Welleneffekt“ (ripple effect)4 (2002) zeigen: Hassgewalt kann auch nicht direkt selbst Betroffene dazu bringen, Vermeidungsstrategien zu verfolgen, die die Selbstdarstellung dieser Menschen beeinflussen können.
Auch Muslim_innen werden als erkenn- und identifizierbar angesehen, und zwar aufgrund äußerer Merkmale wie Bärte, Kleidungsstücke, Gewänder oder Kopfbedeckungen (bzw. Verschleierungen) für Frauen. Die Gefahr von Gewalt, die damit verbunden ist, auffällig zu sein, zwingt sie dazu, ihre Erkennbarkeit in bestimmten Kontexten zu überdenken. Denn ihre Erkennbarkeit wird zum Auslöser für Angriffe von außen durch Täter_innen, die aufgrund der Kleidung Musliminnen und Muslime sehen (wollen). Folglich sprachen viele unserer Befragten davon, sichtbare Äußerungen des Selbst zu verändern, um sich vor potenziellen Belästigungen und Gewalt zu schützen. Das gilt insbesondere für muslimische Frauen, die besonders gefährdet sind. Diejenigen, die sich für eine Kopfbedeckung entscheiden, werden stellvertretend für alles verantwortlich gemacht, was im Islam ‚falsch‘ laufe.
"Wir sehen, ähm, dass die Mädchen anfangen, einige Mädchen ziehen ihre Hijabs aus. Manche versuchen, sich zu schützen oder als politisches Zeichen. Im Grunde, um sich unter die Leute zu mischen und von ihnen akzeptiert zu werden. Weil es für Kinder zu schwer ist, ausgegrenzt zu werden. Sie haben ihre Grüppchen und dies und das. Ich meine, ich sehe die Auswirkungen, die psychologischen Auswirkungen auf die jüngere Generation. Daran besteht kein Zweifel." (Weibliche Befragte)
Tatsächlich überlegten viele Interviewte, ob es noch sicher sei, den Hijab oder eine andere Form der Kopfbededeckung zu tragen. Für sie ist es ein Dilemma – sich entscheiden zu müssen zwischen dem Ausleben der eigenen Identität und der Aufrechterhaltung der eigenen Sicherheit. Solche Erfahrungen beeinträchtigen das Gefühl innerer Ruhe und Zugehörigkeit zur sozialen Umgebung. Denn sie müssen immer wieder darüber nachdenken, ob sie ihre persönliche Selbstdarstellung in Bezug auf Ethnie und Religion an die sozial anerkannten Regeln anpassen. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass Muslim_innen ihre Lebensumstände verändern. In dieser Hinsicht dient das Potenzial antimuslimischer Gewalt dem beabsichtigten Zweck: Es erzwingt ein ‚angemessenes‘ öffentliches Verhalten. Es ist anzunehmen, dass dies zu einer weiteren Abgrenzung zwischen Muslim_innen und Nicht-Muslim_innen führt. Gewalt und die Androhung von Gewalt sind wirksame Instrumente, um zunächst die physische Trennung von Weißen und Nichtweißen, Christ_innen und Nichtchrist_innen zu verstärken – und danach auch ihre sozio-kulturelle Abgrenzung.
Mobilisierung
Es überrascht nicht, dass viele Reaktionen negativ sind. Aber es zeigte sich auch eine Bereitschaft, konstruktiv zu reagieren. Die von Hassgewalt Betroffenen können demnach Alternativen zu den Vorurteilen und der Gewalt entwickeln, mit denen sie konfrontiert sind. Ein indigener Mann meinte, Hass könne verlernt werden. „Ich denke, es ist gelernt. Es wird teilweise in unserem Bildungssystem gelernt, es wird zu Hause gelernt und durch die Medienkultur gelernt. Ich vermute, die einzige gute Nachricht ist, dass Hass auch wieder verlernt werden kann.“
Es gab Befragte, die in Bezug auf das Potenzial für Veränderungen relativ optimistisch waren. Sie schlugen vor, die Energie lebhafter Communitys zu nutzen, um dem Potenzial und den Auswirkungen von Hasskriminalität entgegenzuwirken, etwa: „Diese Geschichte motiviert mich, Menschen weiterzubilden, damit zukünftige Generationen mehr Akzeptanz und weniger Angst haben. Bildung ist der Schlüssel zur Beseitigung irrationaler Ängste.“ Viele gaben an, sich inspiriert zu fühlen, auf individueller und/oder kollektiver Ebene zu reagieren:
"Um zu versuchen, Homosexuellenrechte und Toleranz zu fördern, spende ich Geld an EGALE, beteilige mich an Protesten, schreibe in lokalen Zeitungen, frage karitative/soziale Einrichtungen in Bezug auf ihre Richtlinien und Ressourcen für den Umgang mit LGBT-Community-Kunden. In dem obigen Szenario würde ich dazu beitragen, eine sachliche Berichterstattung in den Medien über das Thema Homophobie/Schwulenhetze zu ermöglichen – vielleicht arbeite ich mit einer Nachbarschaftsgruppe zusammen, die sich mit dem Thema befasst." (Schwuler Mann)
Es sind solche Reaktionen auf die Normativität der Gewalt, die letztlich die beste Verteidigung darstellen. Es gilt, den Moment der Viktimisierung zu nutzen, um Unterdrückung zu benennen und dagegen vorzugehen. Insbesondere sagt es den Täter_innen, dass die betroffenen Communitys sich weigern, an dem ihnen zugewiesenen Platz zu bleiben. Stattdessen kämpfen sie für eine rekonstruierende Umdeutung dessen, was genau dieser Ort ist. Darüber hinaus sendet dieser Widerstand eine nachdrückliche Botschaft der Stärke und Solidarität an die Communitys selbst.
Eine Herausforderung für die kanadischen Werte des Multikulturalismus
Wenn wir die ideologischen Grundlagen von Trudeaus6 Vision des kanadischen Multikulturalismus genau betrachten, werden die gesellschaftlichen und sozialen Schäden von Hasskriminalität besonders deutlich. Zentrale ‚Mythen‘ des Multikulturalismus umfassen die Annahme, dass Politik und Praxis sicherstellen, dass kulturell verschiedene Gruppen:
- ihre Identität bewahren und pflegen können,
- Hindernisse für die uneingeschränkte Beteiligung auf allen Ebenen der kanadischen Gesellschaft beseitigen,
- sich sinnvoll und konstruktiv austauschen können (Ungerleider 2006: 206).
Diese Schlüsselelemente des multikulturellen Diskurses in Kanada bilden den Kern des ideologischen Verständnisses unserer Nation. Als Kanadier_innen sind wir stolz auf unsere Selbstverpflichtung, alle willkommen zu heißen. International sind wir seit Langem anerkannt als ‚erfolgreich‘ im Umgang mit Unterschieden. Aber genau diese Mythen werden durch Hasskriminalität sehr deutlich widerlegt. Die zugrunde liegenden Normen und Werte entsprechen nicht notwendigerweise der alltäglichen Realität der Communitys, die Hassgewalt erleben und befürchten müssen. Denn diese Gewalt ist durch Ideale motiviert, die im direkten Gegensatz zu den Idealen des nationalen Mantras stehen. Die Botschaften von Inklusion, Partizipation und verbindlichem Engagement werden karikiert durch ihre Spiegelbilder in Form von Gewalttaten, die von Rassismus, Heterosexismus und anderen verwandten „Ismen″ inspiriert sind.
Hasskriminalität stellt nicht nur die Identität der Betroffenen und ihrer Communitys infrage, sondern auch unser nationales Engagement für Toleranz und Inklusion. Das Fortbestehen von Hasskriminalität ist eine Herausforderung für die demokratischen Ideale. Es offenbart die Brüche unserer Gesellschaften und enthüllt die ihnen eigene Bigotterie. Kurz gesagt: Die Langlebigkeit von Hasskriminalität – mit periodischem Auf und Ab – bildet einen extremen Widerspruch zu den kanadischen Grundannahmen des Multikulturalismus. Der Schock und das Unverständnis, das die Teilnehmenden meiner aktuellen Studie über Hasskriminalität zum Ausdruck bringen, sind symptomatisch für einen Verlust der Unschuld in Bezug auf die kanadischen Werte. Der Schock ist immer wieder auch eine Spiegelung zerstörter Illusionen. Äußerungen wie die folgenden finden sich in meinen Studien immer wieder. Sie unterstreichen die Fragilität des Mantras des Multikulturalismus:
"Das ist ein Verbrechen. Ich bin sehr traurig wegen Jim, aber ich fühle auch eine Traurigkeit über den Zustand einer Gemeinschaft, in der Leute es für angebracht halten, jemanden wegen seiner Orientierung zu belästigen. (Schwuler Mann)
Die Verletzung ist stark, da wir in Kanada ohne Angst vor Angriffen in der Gesellschaft leben sollten." (Mann muslimischen Glaubens)
Abschließende Gedanken
Die hier vorgestellten Erzählungen bestätigen Lims (2009: 119) Beobachtung, dass das Potenzial für Hasskriminalität die gefährdeten Communitys durchdringt, dass die Communitys Gewalt erwarten und damit umgehen müssen. Wir haben gesehen, wie das Bewusstsein über Hassgewalt in den betroffenen Communitys Angst und Bestürzung erzeugt, wie Hassgewalt als normativ angesehen wird und wie sie sich auf die Mobilität und den Ausdruck der eigenen Identität auswirkt. Aber wir haben auch gesehen, dass Wut und Frustration über Hassgewalt Individuen zum Handeln motivieren kann. Hasskriminalität hat starke negative Auswirkungen auf betroffene Communitys. Insbesondere scheint es, dass sich die Mitglieder der Communitys verletzlich und unsicher fühlen. Das heißt, sie scheinen zu erkennen, dass sie, wo auch immer sie gerade sind, den Anlass für ihre eigene potenzielle Viktimisierung in sich tragen (Lim 2009: 189). Die Befragten haben bewusst wahrgenommen: Hasskriminalität stellt einen Angriff auf ihre Identität dar und ist kein zufälliger Vorfall, der auf ein bestimmtes Individuum abzielt. Hasskriminalität ist demnach eine symbolische Handlung, die für ganz bestimmte Zielgruppen ausgeübt wird – nämlich für die, zu denen der oder die Betroffene gehört. Die Studie weist auf das Potenzial des Widerstandes der Betroffenen und ihrer Communitys gegenüber Hass und Vorurteilen hin – als eine mögliche Ressource, aus der kohärente, wirksame und nachhaltige Politik sowie juristische und pädagogische Strategien hervorgehen können. Wenn Unterschiedlichkeit in Bezug auf hegemoniale Identitäten konstruiert und gelebt wird, kann auch sie rekonstruiert und anders gelebt werden. Dies kann nur gelingen, wenn untergeordnete Gruppen und ihre Mitglieder ermutigt werden, die Normativität des Hasses infrage zu stellen.
1 Ins Deutsche übertragen von Daniel Geschke.
2 Anmerkung des Übersetzers: Fokusgruppen sind strukturierte Diskussionsrunden zu einem bestimmten Thema.
3 Anmerkung des Übersetzers: LGBT steht im Englischen für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, auf Deutsch lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich.
4 Anmerkung des Übersetzers: Noelle (2002) beschreibt in dieser Studie die negativen Auswirkungen eines homofeindlichen Mordes auf nicht betroffene Mitglieder der LGBT-Community und benennt diese als ripple effect, der sich wie Wellen in der Community verbreitet.
5
Anmerkung des Übersetzers: EGALE ist eine Menschenrechtsorganisation in Kanada, siehe egale.ca [18.10.2018].
6 Anmerkung des Übersetzers: Pierre Trudeau, von 1968 bis 1984 Premierminister Kanadas, Vater des aktuellen Premierministers Justin Trudeau.
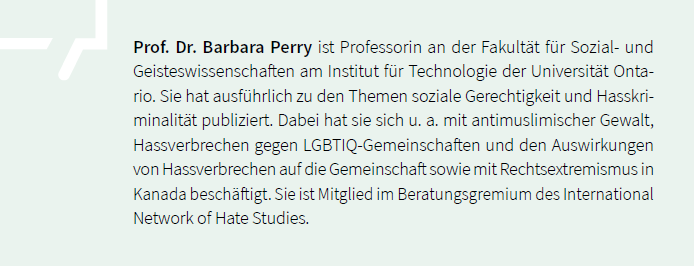
Literatur
Craig-Henderson, Kellina (2009): The psychological harms of hate: Implications and interventions. In: Iganski, Paul [Hrsg.]: Hate Crimes: The Consequences of Hate Crime. Praeger: Westport, S. 15-30.
Hate Crimes Community Working Group (2006): Addressing Hate Crime in Ontario. Attorney General and Minister of Community Safety and Correctional Services: Toronto.
Herek, Gregory M./Cogan, Jenine C./Gillis, J. Roy (2002): Victim experiences in hate crimes based on sexual orientation. In: Journal of Social Issues, 58, Heft 2, S. 319-339.
Iganski, Paul (2001): Hate crimes hurt more. In: American Behavior Scientist, 45, Heft 4, S. 627-638.
Iganski, Paul/Lagou, Spiridoula (2009): How hate crimes hurt more: Evidence from the British Crime Survey. In: Iganski, Paul [Hrsg.]: Hate Crimes: The Consequences of Hate Crime. Praeger: Westport, S. 1-14.
Levin, Jack & McDevitt, Jack (1993): Hate crimes: The rising tide of bigotry and bloodshed. Plenum: New York.
Lim, Helen A. (2009): Beyond the immediate victim: Understanding hate crimes as message crimes. In: Iganski, Paul [Hrsg.]: Hate Crimes: The Consequences of Hate Crime. Praeger: Westport, S. 107-122.
Mason, Gail (2009): Body Maps: Envisaging Homophobia, Violence, and Safety. In: Iganski, Paul [Hrsg.]: Hate Crimes: The Consequences of Hate Crime, Praeger: Westport, S. 49-72.
McDevitt, Jack/Balboni, Jennifer/Garcia, Luis/Gu, Joann (2001): Consequences for victims: A comparison of bias- and non-bias motivated assaults. In: American Behavioral Scientist, 45, Heft 4, S. 697-711.
Noelle, Monique (2002): The ripple effect of the Matthew Shepard murder: Impact on the assumptive worlds of members of the targeted group. In: American Behavioral Scientist, 46, Heft 1, S. 27-50.
Noelle, Monique (2009): The psychological and social effects of anti-bisexual, anti-gay, and anti-lesbian violence and harassment. In: Iganski, Paul [Hrsg.]: Hate Crimes: The Consequences of Hate Crime. Praeger: Westport, S. 73-106.
Perry, Barbara (2001): In the name of hate. Routledge: New York.
Perry, Barbara (2008): Silent Victims: Hate Crimes Against Native Americans. University of Arizona Press: Tucson.
Ungerleider, Charles S. (2006): Immigration, Multiculturalism, and Citizenship: The Development of the Canadian Social Justice Infrastructure. In: Hier, Sean P./Bolaria, B. Singh [Hrsg.]: Identity and Belonging: Rethinking Race and Ethnicity in Canadian Society. Canadian Scholars’ Press: Toronto, S. 201-216.
Weinstein, James (1992): First amendment challenges to hate crime legislation: Where’s the speech? In: Criminal Justice Ethics, 11, Heft 2, S. 6-20.
Young, Iris M. (1995): Five faces of oppression. In Harris, Dean A. [Hrsg.]: Multiculturalism from the margins. Non-Dominant Voices on Difference and Diversity. Bergin and Garvey: Westport, S. 65-86.


