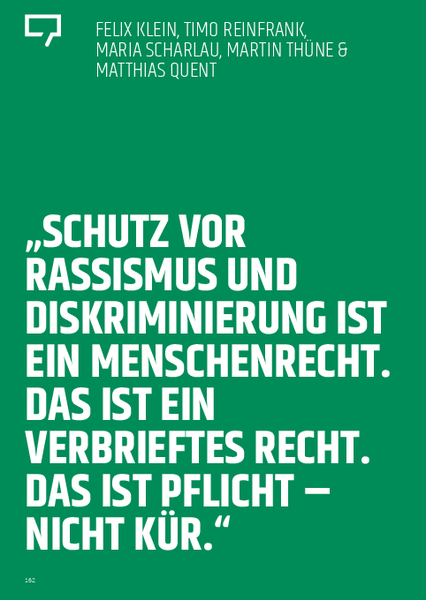Matthias Quent:
In diesem Abschlusspodium möchten wir zentrale Fragen der Tagung zusammenfassend und mit einem Ausblick in die Zukunft erörtern. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir für die weitere Praxis in Zivilgesellschaft, Politik und Forschung?
Wir haben in den Workshops und in den gestrigen Veranstaltungen ein großes Spektrum von Themen behandelt: methodologische und begriffliche Herausforderungen, Fragen der phänomenübergreifenden oder phänomenspezifischen Behandlung von Hasskriminalität. Zu den wichtigsten Befunden zählen die statistischen Daten aus anderen Ländern: aus Kanada, Großbritannien und den USA. Die Zahlen sind auch dort in den letzten Jahren angestiegen, insbesondere im Bereich Antisemitismus, aber auch im Phänomenbereich Hasskriminalität, aufgrund von Verschiebungen im politischen Spektrum.1 Wir haben es also nicht nur mit einem ostdeutschen oder einem deutschen Problem zu tun. Wir haben andiskutiert, welche Rolle internationale Berichte durch zivilgesellschaftliche und supranationale Institutionen einnehmen können, um politischen Druck auszuüben – durch ein Monitoring, also durch die Erfassung und Darstellung von Gewalt gegen Minderheiten, mit den verschiedenen Instrumentarien zivilgesellschaftlicher, polizeilicher, juristischer und wissenschaftlicher Methoden.
Deswegen meine ersten Fragen an Sie, Frau Dr. Scharlau: Sie schreiben bei Amnesty International solche Berichte. Was ist Ihre Wahrnehmung der Themen der Diskussionen hier auf der Tagung? Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen im internationalen Kontext? Was sind aktuelle Herausforderungen? Wie könnten wir dafür sorgen, dass die Erfassung und Problematisierung dieser Herausforderungen politisch ernst genommen werden?
Maria Scharlau:
Aus Sicht von Amnesty International ist der Ausgangspunkt von allem der Schutz vor Rassismus und Diskriminierung. Das ist ein Menschenrecht. Das ist ein verbrieftes Recht. Das ist Pflicht – nicht Kür.
Aber sogar an diesem basalen Statement muss man in Deutschland noch arbeiten. Wir haben 2016 zum Thema rassistische Gewalt den Bericht „Leben in Unsicherheit: Wie Deutschland die Opfer rassistischer Gewalt im Stich lässt“ herausgegeben2. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation und arbeiten auf Grundlage internationaler Menschenrechte, aber betrachten auch die Situation in Deutschland. Die Empfehlungen dieses Berichtes decken sich sehr weitgehend mit den Ergebnissen, die hier im Laufe der Konferenz zusammengetragen wurden. Es geht letztendlich bei Hasskriminalität um das Verhindern, Erfassen, Ermitteln und Bestrafen – und um starke Solidarisierung mit den Betroffenen.
Das aktuelle PMK-System ist wenig transparent und ein Riesenproblem. Zur Dokumentation von Hasskriminalität brauchen wir genaue Zahlen und Informationen. Wir können diese Daten aber nicht selbst erheben. Es wenden sich immer wieder Betroffene an Amnesty International. Wir machen aber leider keine Einzelfallberatung und dokumentieren keine Einzelfälle. Für den Bericht haben wir es getan, aber daraus ergibt sich natürlich noch keine systematische statistische Erhebung. Das kennen wir aus allen Berichten und auch von der Menschenrechtsarbeit: Ohne eine ordentliche statistische Erfassung lässt sich das Problem nicht genau benennen und es ist leicht, es herunterzuspielen. Deswegen fordern wir Verbesserungen der Statistik und Schulungen bei Polizei und Justiz. Diese Schulungen müssen tatsächlich verpflichtend sein, denn da, wo solche Schulungen nur eine Möglichkeit von vielen sind, geht man eher nicht zu etwas, das ‚Anti-Rassismus-Training‘ heißt. Man muss in dem Bereich Erfassen, Ermitteln, Bestrafen thematisieren – das ist auch ein Ergebnis unseres Berichtes –, was für ein Problem wir in Deutschland mit institutionellem Rassismus haben.
Zum Thema ‚Verhindern‘: Es ist eine Grundaufgabe der Zivilgesellschaft und der Gesellschaft insgesamt, Rassismus generell entgegenzutreten. Eine Gesellschaft, in der rassistische Ressentiments wieder salonfähig werden und wo rechtspopulistische Positionen vertreten werden, ist ein Nährboden für Gewalt.
Und hier würde ich gern auf den internationalen Rassismus-Begriff hinweisen. Er ist in der UN-Konvention gegen Rassismus und Diskriminierung3 von 1965 festgehalten und unterscheidet sich stark vom Verständnis von Rassismus in Deutschland. Es geht hier um juristische Definitionen, die weitgehende Folgen haben. In Deutschland und auch in deutschen Behörden wird immer davon ausgegangen: Rassismus, das sind die übriggebliebenen Nazis von 1945, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, bestimmte Bevölkerungsgruppen auszulöschen. In der Rassismusdefinition der UN-Konvention ist aber ganz deutlich verankert: Rassismus liegt auch dann vor, wenn Ziel oder Wirkung eines Handelns Diskriminierung und Ausgrenzung sind. Rassistisches Handeln ist also auch ohne explizit rassistische Haltung möglich.
Beim institutionellen Rassismus geht es nicht darum, zu sagen: Die einzelnen Personen, also die Menschen in einer Institution, sind Rassist_innen und haben eine rassistische Gesinnung. Man sagt stattdessen: Die Behörde versagt im Umgang mit bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und das geht zurück auf eine Leerstelle im Hinblick auf das Verständnis rassistischer Ressentiments, die in dieser Behörde und in dieser Gesellschaft noch vorhanden sind und gelebt werden. Ich kenne das aus meiner Arbeit mit der Polizei. Ich bin oft bei Fachtagungen der Polizei. Wenn ich institutionellen Rassismus thematisiere und genau erkläre, dann ist trotzdem am Ende jemand da, der aufsteht und von sich sagt: Ich bin doch aber gar kein Rassist.
Man braucht Verbündete in jeder Behörde – auch in der Polizei. Manchmal kommen Polizist_innen auf uns zu und sagen: Können wir nicht was zu ‚Racial Profiling‘ machen? Dann denke ich mir: ‚Ja, können wir, aber reden Sie mit Expert_innen, mit Selbstorganisationen. Bringen Sie die mit an den Tisch.‘ Da sehen wir als Amnesty unsere Funktion ganz stark als Mittlerrolle. Ganz wichtig ist es, sich zu solidarisieren und sich zu jedem Zeitpunkt an die Seite der Betroffenen zu stellen und ihnen eine Stimme zu geben.
Und jetzt als Abschluss zu den Menschenrechten: Es gibt den UN-CERD, also die Konvention gegen Rassismus. Im Rahmen dessen gibt es Berichtsverfahren – auch Deutschland muss auf der Basis bestimmter angefragter Punkte regelmäßig einen Menschrechtsbericht verfassen4, genau wie Deutschland auch zum UN-Zivilpakt berichten muss und regelmäßig Gegenstand einer sogenannten UPR-Anhörung vor dem Menschenrechtsrat ist. Die Zivilgesellschaft kann in all diesen Fällen Schattenberichte erstellen.5 Anhand dieser Berichte gibt der Ausschuss dann Empfehlungen. Ich kann alle nur ermuntern, die CERD-Empfehlungen von 2015 zu Deutschland6 zu lesen. Da ist alles, was wir hier bei der Tagung diskutiert haben, fein säuberlich aufgelistet: angefangen von der statistischen Erfassung über die obligatorischen Schulungen von Polizei und Justiz, über die Ausweitung des Rassismus-Begriffs, über den Fokus auf die Betroffenen bis hin zum ,Racial Profiling‘. Es ist uns ein Anliegen, diese Mechanismen deutlicher zu machen und in die Öffentlichkeit zu rücken.
Matthias Quent:
Martin Thüne, wir haben hier oftmals gehört, nötig seien bessere statistische Erfassung von Gewalt gegen Minderheiten sowie Sensibilisierung und Aus- und Fortbildung der Polizei. Unter anderem ist das Ihr Aufgabenfeld in Thüringen. Was passiert bereits in diesen Bereichen? Wo sind Stellschrauben? Braucht es Gesetzgebungen, die verbindliche Verpflichtungen schaffen und somit über freiwilliges Engagement und Appelle hinausgehen?
Martin Thüne:
Ich glaube, es braucht beides. Sicherlich brauchen wir eine Sensibilisierung. Ich kann das nur für Thüringen sagen, aber gerade der NSU war eine Zäsur, die zur Gründung der Extremismuspräventionsstelle geführt hat. Diese Stelle hat sich es zur Aufgabe gemacht, Fortbildungsmöglichkeiten zu schaffen, um das Wissen auch in die Fläche zu bekommen. Man braucht neben diesen Fortbildungen ein Stück weit gesetzliche Vorgaben und Druck von oben. Aber aus kriminologischer Perspektive wissen wir: Gesetze sind immer nur das eine. Die Frage ist: Ist der Wille da und wird er dann auch an die Behörden übertragen? Und ist, vor allem bei den Behördenleitungen, der Wille da, darauf zu achten, dass die vorhandenen Gesetzesvorgaben und Bildungsangebote wirklich in die Praxis umgesetzt werden? Was passiert, wenn das nicht gemacht wird? Wird dann interveniert und sanktioniert oder wird zumindest mal kritisch nachgefragt? An diesem Punkt ist noch Optimierungspotenzial. Das ist aus meiner Sicht der erste Punkt – noch vor Gesetzesvorgaben: ein Philosophiewandel in den Behörden, der von der Führung mitgetragen und dann nach unten durchgegeben wird. Aber gerade bei Sicherheitsbehörden braucht es gesetzliche Regelungen, denn die Logik solcher Institutionen ist: Man richtet sich an Regeln aus und wenn diese fehlen, ist es schwierig.
Matthias Quent:
Herr Dr. Klein, es wurde bereits darauf hingewiesen, wie nötig klare Begrifflichkeiten sind sowie ein erweitertes Verständnis von Rassismus. Wie sind Ihre Erfahrungen nach den ersten Monaten im Amt? Ist in Bezug auf Antisemitismus in Behörden und Institutionen ein Begriffsverständnis vorhanden, um die Realität abbilden zu können?
Felix Klein:
Ich sehe in diesem Bereich erheblichen Handlungsbedarf – etwa bei dem Angriff auf ein als jüdisch wahrgenommenes Restaurant in Chemnitz7. Neonazis haben sich verabredet und versammelt, den Besitzer herausgerufen und kaltblütig antisemitisch beleidigt. Wenn so ein Vorfall von der Polizei als versuchte Sachbeschädigung behandelt wird, wie es 10 Tage lang der Fall war, zeigt das: Wir haben hier wirklich noch viel zu tun. Wenn solche Fälle in den richtigen Bahnen landen – also in dem Fall beim Staatsschutz –, dann läuft es schon gut. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das Wissen in die Breite kommt. Damit die Polizeistreife vor Ort einen solchen Fall sofort als „antisemitische Straftat“ einordnen kann und den Staatsschutz damit beauftragt.
Wir haben Instrumente an der Hand, Antisemitismus zu erkennen und einzuordnen. Es gibt eine Antisemitismus-Definition, die die Bundesregierung im September letzten Jahres zwar als „rechtlich nicht verbindlich“, aber doch zur Annahme empfohlen hat. Das ist ein Text, den die europäische Monitoring-Menschenrechtsstelle verfasst hat und den die Internationale Allianz für Holocaust-Gedenken (IHRA) 2015 verabschiedet hat. Ich zitiere:
"Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen."
Das ist eine offene Definition, die mit Beispielen erläutert wird. Die Definition müsste bei Polizei und Staatsanwaltschaft bekannter gemacht werden. Die Bekämpfung des Antisemitismus scheitert oft schon daran, dass er von handelnden Personen nicht als solcher erkannt wird. Hier müssen wir Aufklärung leisten. Ich stimme Herrn Thüne sehr zu: Nötig sind verpflichtende Fortbildungen oder Wissensvermittlung als Teil der Ausbildung mit Examensrelevanz. Wichtig ist zudem, die verschiedenen Akteur_innen miteinander zu vernetzen. Die Amadeu-Antonio-Stiftung ist da sehr aktiv. Ziel muss es sein, Sensibilität zu schaffen, Akteur_innen miteinander zu vernetzen und zur Sichtbarkeit des Problems beitragen.
Meine Aufgabe sehe ich darin, dass ich in der Presse und bei Veranstaltungen immer wieder Stellung nehme, in Schulen gehe und den Menschen klar mache: Es gibt eindeutigen Handlungsbedarf durch Nichtwissen und Gleichgültigkeit. Da müssen wir uns ganz klar widersetzen und da gibt es viele Verbündete. Amnesty macht auch sehr gute und wichtige Arbeit zur Sensibilisierung. Jetzt, mit der Schaffung meines Amtes, gibt es im Bereich des Antisemitismus eine Art Paradigmenwechsel, denn die Politik hat erkannt: Trotz der vielfältigen Maßnahmen, die wir in den letzten Jahrzehnten ergriffen haben, haben wir es im Bereich Antisemitismus noch nicht geschafft, ihn systematisch mit einer Strategie zu bekämpfen. Wir müssen die Akteur_innen von Bund und Ländern und Zivilgesellschaft noch stärker miteinander verzahnen – auch die Schulen und Gedenkstätten.
Matthias Quent:
Zivilgesellschaft, Politik, Polizei, phänomen- und gruppenspezifische Ansätze, gruppenübergreifende Ansätze – das ist alles andere als ein konfliktfreies Feld. Timo Reinfrank: Was ist Deine Wahrnehmung von solchen Kooperationen, von der aktuellen Situation und von dem, was jetzt in diesem Verbund getan werden müsste? Wo müsste es hingehen mit diesem auch auf vielen Seiten vorhandenen Bewusstsein, dass man Synergien schaffen und stärken muss. Wo sind da auch Stolperfallen?
Timo Reinfrank:
Du hattest ja eingangs gefragt: Was kann man von dieser Tagung mitnehmen? Ich würde gern etwas mitbringen und vom Treffen mit dem Menschenrechtsbeauftragten (Human Rights Commissioner) der Stadt New York erzählen. Wir sind hingefahren, um zu schauen, was sie so machen. Ich dachte, wir treffen uns mit einer Person, aber wir trafen zehn, weil für alle Minderheiten jeweils ein_e Vertreter_in mit anwesend war. Es gab natürlich eine Vorsitzende, aber auch das rotiert. Die Stadt New York hat eine Institution eingerichtet, die systematisch nach Diskriminierung ihrer Bürger_innen sucht. Sie stellt in den verschiedenen Stadtteilen Anwaltsbüros zur Verfügung, wo man gegen die Stadt klagen kann. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das ist ein wirklich systematischer, guter Versuch, etwas zu verändern.
Was es braucht? Ich spreche jetzt nur für die Amadeu Antonio Stiftung: Es braucht sehr viel mehr Professionalität im Umgang mit Antisemitismus, Rassismus und Gewalt gegen Minderheiten und wir sind als Zivilgesellschaft gefragt, diese einzufordern. Wir merken immer, dass es Konjunkturen gibt. Nach der Selbstaufdeckung des NSU war ganz viel möglich: Es gab zum Beispiel Kolleg_innen aus einer zivilgesellschaftlichen Institution, die an wöchentlichen Lageeinschätzungen mit dem Innenminister eines Bundeslandes teilgenommen haben. Da hatte man erkannt, dass man zivilgesellschaftliche und polizeiliche Lageeinschätzungen sehr schnell abgleichen muss, um zeitnah zu reagieren. Inzwischen wissen wir: Es gibt gewaltmobilisierende Narrative und daraus folgt häufig Gewalt. Chemnitz ist für mich das beste Beispiel. Wenn es der Polizei oder der Zivilgesellschaft nicht gelingt, klare Grenzen zu setzen und eskalierende rechtsextreme Mobilisierungen schnell einzufangen, ist es ein Signal in die Szene und führt zu einer weiteren Enthemmung der Gewalt. Hier befinden wir uns im Moment an einem Scheideweg.
Ich will ganz deutlich sagen: Es gibt ein ambivalentes Verhältnis zwischen Polizei und Zivilgesellschaft und das gibt es zurecht. Aber wir haben die Möglichkeiten zur Kooperation mit der Polizei nicht genutzt. Es mag gute Gründe dafür geben. Bei den aktuellen Ermittlungen gegen die rechtsextreme Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern haben wir zum Beispiel als Stiftung gemerkt, wie schnell auch Polizist_innen Teil dieser Szene sein können und Informationen weitergeben. Also seien Sie vorsichtig, mit wem Sie zusammenarbeiten. Aber es gibt auch sehr ermutigende Beispiele der Kooperation. Ich bin sehr beeindruckt, wie weit die Berliner Polizei im Umgang mit trans- und homofeindlichen Straftaten und in der Kooperation mit Selbstorganisationen ist – also wie die Polizist_innen das dort zu ihrer Sache gemacht haben, solche Straftaten zu verhindern. So etwas will ich auch für alle anderen Bereiche haben. Deswegen ist mein Wunsch, von Herrn Klein zu lernen und zu fragen: Wie können wir denn noch andere ähnliche Institutionen aufbauen? Oder den LSVD zu fragen: Was haben sie gemacht, dass die Berliner Polizei da so erfolgreich ist?
Mich wundert – auch im internationalen Vergleich –, dass die Debatte um institutionelle Diskriminierung bzw. institutionellen Rassismus in Deutschland viel zu wenig geführt wird. Beispiel Cottbus: Durch ständige Polizeikontrollen, Durchsuchungen nach Drogen etc. bewirkt die Polizei mit solchen Aktionen in kleinen Städten, dass die Bevölkerung ein negatives Bild von Flüchtlingen hat.
Matthias Quent:
Demnächst gibt es eine Serie mit dem Titel „Law & Order Hate Crimes“ – also eine populär-mediale Aufbereitung der Arbeit spezieller Polizeigruppen in New York City, die sich mit Hasskriminalität beschäftigen. Wir haben bisher die Bereiche von Polizei und Justiz fokussiert. Wir haben in den Arbeitsgruppen darüber geredet, dass das Thema Hasskriminalität auch an den Hochschulen viel zu kurz kommt, gerade in der juristischen Ausbildung und generell im Bildungsbereich. Müssten wir nicht perspektivisch stärker out-of-the-box denken? Welche Möglichkeiten zur Sensibilisierung gibt es jenseits dieser fast schon rituellen Wechselseitigkeit ‚Zivilgesellschaft – Politik – Polizei‘? Gibt es dafür flächendeckend in Deutschland das Potenzial und Ansprechpartner_innen, die mitziehen? Die Berliner Polizei ist schon sehr weit. Gibt es in Thüringen Möglichkeiten und ganz konkrete Ansätze, so etwas von innen heraus zu etablieren? Oder sind es in Wirklichkeit ganz andere Themen, die den Alltag der meisten Polizist_innen in der Ausbildung und Praxis prägen?
Martin Thüne:
Ja, es gibt diese Ansätze. In unseren Behörden in der Thüringer Polizei gibt es viele Kolleg_innen, die auf solche Signale warten, die sich eine Öffnung wünschen und denen dieser Öffnungsprozess zu langsam geht. Es gibt natürlich auch andere, die sich dem aus einer tradierten Denkweise heraus eher ein bisschen verschließen – also sich beispielsweise mal zu konkreten Sachverhalten mit externen Akteur_innen zusammenzusetzen und gemeinsam zu besprechen, was andere aus ihrer Profession für eine Sicht haben. Dass uns derartige Kooperationen alle nur weiterbringen können, das hat sich noch nicht zu 100 Prozent durchgesetzt. Daran müssen wir arbeiten. In unserer Extremismuspräventionsstelle haben wir verschiedene Kooperationen geschlossen: mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. (ZWST), mit Interessenvertretungen von Sinti und Roma, mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) und so weiter. Aber nur, weil der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, heißt das nicht, dass er immer schön weiter rollt. Wir müssen also aufpassen, den Prozess am Laufen zu halten und da sehe ich noch Optimierungspotenzial.
Timo Reinfrank:
Mir fallen viele Sachen ein. Ich will erst mal selbstkritisch sagen: Ich finde, die zivilgesellschaftlichen Organisationen selbst sollten sich viel mehr den Perspektiven der Betroffenen öffnen. Bisher gibt es viel zu wenig Sensibilität dafür, was es heißt, von einer bestimmten Art von Ausgrenzung oder Diskriminierung betroffen zu sein. Und natürlich muss die aktive Zivilgesellschaft diverser werden. Denn die gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelt sich häufig in den zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht wider.
Felix Klein:
Ich sehe es als meine vordringlichste Aufgabe an, den Stein im Rollen zu halten, zum Beispiel mit der Forderung, dass auch die Bundesländer Beauftragte im Kampf gegen Antisemitismus einsetzen sollten. Da gibt es jetzt mehr und mehr, die sich darüber Gedanken machen. Ich bin mit Einzelprojekten in Kontakt, z. B. mit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS). Das erste Großprojekt, was ich mir vorgenommen habe, ist die Schaffung eines Erfassungssystems antisemitischer Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ziel ist es, Transparenz über solche Vorfälle zu schaffen und die Dunkelziffer zu verkleinern. Inzwischen habe ich sehr viel in der Presse und bei Betroffenen darüber gesprochen und es gibt es zunehmend mehr Organisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Raum, die sich melden und mitmachen möchten. Gemeinsam kann man dabei gut Hand in Hand arbeiten und zu einer positiven Dynamik beitragen.
Maria Scharlau:
Mich persönlich treibt um: Wie kommen wir in die Fläche? Wie kommen wir in die Realität? Amnesty hat da super Voraussetzungen, denn wir sind in der Fläche. Wir haben unsere Gruppen eigentlich überall, auch im Osten. Unser Slogan bei einer Kampagne war zum Beispiel: „Wir nehmen Rassismus persönlich“. Unser Ziel war, klar zu machen: Wenn jemand rassistisch angegriffen wird, dann betrifft mich das persönlich. Auch wenn der Angriff nicht mir gilt, nehme ich das persönlich, weil ein Angriff auf meine Vorstellung einer freien und vielfältigen Gesellschaft verübt wird. Unser Ziel ist, dass wir gemeinsam eine solche Gesellschaft entwickeln. Ziel der Kampagne war es, dass mehr Leute bei Rassismus eine rote Linie ziehen bzw. sich dazu ermächtigt bzw. empowert fühlen.
Und ja, auch Amnesty muss diverser werden. Dieses Problem haben wir und wir arbeiten daran. Aber das geht langsam. Wir müssen vielfältiger werden, damit man genau diese ganzen Aspekte auch lebt, z. B. die Solidarität.
Noch ein letzter Punkt: Es ist tatsächlich manchmal auch ein Föderalismus-Problem, zum Beispiel das Thema Polizei. Es sind 17 Systeme, wenn man die Bundespolizei mitzählt. Wir sollten jedenfalls mehr Best-Practice-Beispiele finden. Wir haben zum Beispiel hervorragende Kontakte nach Bremen, die machen eine sehr gute Arbeit, z. B. zum Thema Vermeidung von rassistischen Polizeikontrollen. Damit kann man andere Polizeibehörden inspirieren und zugleich zeigen, wo und wie es schon sehr gut läuft.
Matthias Quent:
Was nehmen wir ganz praktisch aus der Tagung mit? Wie können wir diese Auseinandersetzung aufrechterhalten und weiterführen?
Timo Reinfrank:
Es ist vielen Leuten unverständlich, warum es wichtig ist, dass sich alle Menschen in einer Gesellschaft gleich gut aufgehoben fühlen. Das hat natürlich viel mit einem bestimmten Verständnis von Normalität zu tun, mit Vorstellungen darüber, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Wir sollten dafür werben, dass wir in einer Gesellschaft der Gleichwertigkeit leben wollen, also in einer Gesellschaft, in der alle gleich viel wert sind.
Felix Klein:
Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Einbettung des Themas Antisemitismus in den Gesamtkontext Rassismus und Hasskriminalität. Wenn es uns gelingt, im Kampf gegen Antisemitismus Erfolge zu erzielen, erledigen wir viele Probleme in anderen Bereichen gleich mit. Die islamistische Gefahr ist ein Beispiel dafür.
Martin Thüne:
Mich hat die Tagung bereichert, zugleich habe ich den ein oder anderen Kritikpunkt: Was nimmt man jetzt wirklich konkret mit? Was sind Vorschläge? Das sollte künftig stärker fokussiert werden. Natürlich liegen in diesem Themenfeld viele Sachen auch einfach auf der Hand und die müssen dann schlicht gemacht werden, beispielsweise bei Sicherheitsbehörden oder Polizei. Viele Probleme sind bereits jetzt klar, da brauchen wir nicht noch drei zusätzliche Studien. Mein Wunsch bzw. meine Forderung an mich selbst und an uns alle: einfach machen und weniger reden.
Maria Scharlau:
Menschenrechte – und darunter fasse ich auch den Schutz vor Rassismus – müssen relevant bleiben. Die Menschen sollten wissen, warum sie für eine Gesellschaft sind, in der Menschenrechte gelten und in der jeder Mensch gleich viel wert ist. Das ist ja der Kern von Menschenrechten. Hoffnungsvoll macht mich, dass so viele Akteur_innen an so vielen Stellen viel gute Arbeit leisten.
Ich frage mich: Wie kommen wir zu einer guten Vernetzung? Visitenkarten tauschen ist nicht alles. Ich würde gerne künftig noch überlegen: Wie kommen wir wirklich ins gemeinsame Handeln? Amnesty ist dafür offen.
1 Anmerkung der Redaktion: vgl. dazu die Beiträge von Barbara Perry „Hasskriminalität: Erfassung und Kontexte aus internationaler Perspektive“ und von Chris Allen „Hasskriminalität in Großbritannien“ in diesem Band.
2
Anmerkung der Redaktion: Bericht online unter www.amnesty.de/sites/default/files/2017-05/Amnesty-Bericht-Rassistische-Gewalt-in-Deutschland-Juni2016.pdf [01.11.2018].
3
Anmerkung der Redaktion: vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte (o.J.): Anti-Rassismus-Konvention (ICERD). Online: www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/anti-rassismus-konvention-icerd/ [01.11.2018].
4 Anmerkung der Redaktion: vgl. Beitrag von Barbara John „Hasskriminalität aus europäischer Perspektive“ in diesem Band.
5
Siehe z. B. den Schattenbericht von Amnesty zur diesjährigen UPR-Anhörung Deutschlands unter www.amnesty.de/2013/9/26/amnesty-stellungnahme-zum-upr-verfahren-deutschlands-vor-dem-uno-menschenrechtsrat [01.11.2018].
6
Anmerkung der Redaktion: siehe hierzu: Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (2015): Schlussbemerkungen zu den 19. bis 22. Staatenberichten der Bundesrepublik Deutschland. Online: www.auswaertiges-amt.de/blob/205272/971a2480a043a34e631546a190bec293/170224-19-22-staatenbericht-schlussbemerk-data.pdf [01.11.2018].
7
Anmerkung der Redaktion: Zu Hintergründen vgl.: Tagesspiegel (2018): Kritik und Entsetzen nach Angriff auf jüdisches Restaurant. Online: www.tagesspiegel.de/politik/chemnitz-kritik-und-entsetzen-nach-angriff-auf-juedisches-restaurant/23014190.html [01.11.2018].