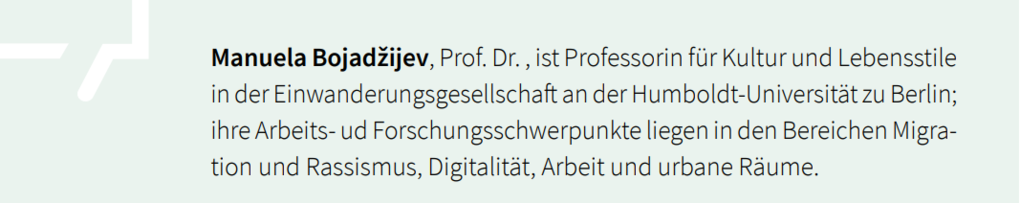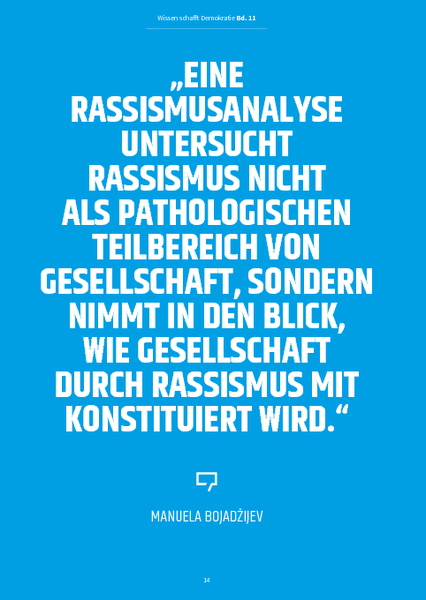Wie würden Sie zunächst erst einmal generell das Rassismusverständnis in der heutigen Diskussion in Deutschland beschreiben?
Zunächst fällt auf, dass ein vereinfachendes Verständnis von Rassismus stark dominiert. Laut dieser Vergröberung geht es bei Rassismus um eine bereits bestimmte soziale Gruppe, die aufgrund äußerer zugeschriebener Merkmale anders und tendenziell schlechter behandelt wird – wobei die Schlechterbehandlung wiederum durch den Rassismus legitimiert werde. Man erkennt gleich die tautologische Struktur des Arguments. Bei einer Reduktion von Rassismus auf Vorurteile ist das zum Beispiel so. Es geht dabei um die Erklärung eines individuellen oder auch kollektiv getragenen Vorurteils gegenüber einer Minderheit aufgrund als voreilig kritisierter Verallgemeinerungen. Vorurteilsforschung kann dann anknüpfend an vorab definierte kulturelle Primärmerkmale eines Samples, zum Beispiel auf der Grundlage einer Hautfarbe, einer Haarfarbe, eines Kleidungsstücks, eines sprachlichen Ausdrucks, eines Namens, einer kulturellen Praxis beschreiben wie jene, die solche Merkmale nicht aufweisen, auf jene mit diesen Merkmalen oftmals gewaltvoll reagieren. Sie kann auch erfassen, wie diejenigen mit diesen oder diejenigen ohne diese Merkmale Ausgestatteten diese Reaktionen und dieses Verhalten interpretieren. Wenn jene mit diesen Merkmalen zum Beispiel aussagen, dass sie das Verhalten als rassistisch empfinden, dann wird ihnen eine gewisse Interpretationshoheit über ihre Erfahrungen eingeräumt oder diese gerade aufgrund ihrer „rein subjektiven“ Wahrnehmung aus wissenschaftlicher Sicht und der Neutralitätsmaßgabe abgestritten. Dagegen ist zu erwarten, dass diejenigen ohne diese Merkmale ihr Verhalten eher als nicht rassistisch auslegen und tendenziell zu verallgemeinernden Ausführungen über den imaginären kollektiven und sozialen Zusammenhang der Gruppe mit den Merkmalen neigen werden. Vorurteilsforschung in diesem vereinfachten Sinne ist wie eine Ärztin, die herbeieilt, um Fieber zu messen, nicht aber um zu heilen. Im besten Fall wird die Patientin trotzdem gesund und sobald die Symptome wiederkehren, wird sie erneut gerufen – eher ein Geschäftsmodell denn eine Heilung.
Wie lässt sich Rassismus stattdessen als komplexes Phänomen beschreiben?
Ich möchte, hier den Überlegungen Étienne Balibars folgend, den Begriff des totalen sozialen Phänomens einbringen, mit dem der Anthropologe Marcel Mauss Anfang des 20. Jahrhunderts den Gabentausch bezeichnet hat. Nach Mauss handelt es sich beim Gabentausch um eine Vielzahl von Praxisformen sowie Diskursen und Vorstellungen, aus denen heraus die Form der sozialen Beziehungen, ihre spezifische „Logik“ erklärt werden können. Rassismus scheint mir die tückische Form davon zu sein. Ähnliches wie für den Gabentausch gilt auch für Rassismus: Dieser stellt gleichzeitig eine juristische, wirtschaftliche, religiöse, soziale, politische, ästhetische und morphologische Tatsache dar. Rassismus ist so gesehen ein äußerst komplex verankertes Phänomen, das nie isoliert auftritt. Rassismus ist nicht auf individuelle Absichten oder Einstellungen zu reduzieren, sondern ein soziales Phänomen, mit subjektivierenden wie unterwerfenden Modi. Er ist darum auch nur in seiner sozialen Funktionsweise zu verstehen. Es geht um soziales Wissen und Handeln. Es geht unter anderem darum, dass, so hat es Étienne Balibar einmal gesagt, Rassismus Wissen über unsere Gesellschaft schafft. Menschen erklären sich und ihre Position in der Welt über Rassismus, wie und warum wir auf diese Weise zusammenleben. Rassismus wirkt darüber hinaus handlungsleitend. Er basiert auf der Vorstellung, dass Menschen in distinkte biologisch genetische Einheiten (Rassen genannt) unterteilt werden könnten. Dabei wurden und werden seit Anbeginn des Rassendenkens sowohl biologische als auch kulturelle Kriterien zugrunde gelegt. Um die Vorstellung, es gäbe Rassen, spinnen sich Narrative, in denen ein angeblicher Zusammenhang von Rasse zum Beispiel mit kulturellen Merkmalen der Persönlichkeit, des Intellekts, der Moral konstruiert wird. Diese reproduzierten sich, so das rassistische Narrativ, genealogisch. Es handelt sich um eine anthropologische Differenzierung oder, wie Stefan Hirschhauer sagt, um eine Humandifferenzierung, die gleichzeitig, so muss man eben hinzufügen, in Genealogien vorgestellt wird – wir vererben demzufolge diese rassistisch gedachten Differenzierungen.
Inwieweit ist Rassismus auch heute noch an diesen Glauben oder das Denken von genetisch differenzierbaren Rassen gebunden?
Ich gehe nicht davon aus, dass Rassismus immer auf ein Verständnis biologisch-genetischer Rassendefinition rekurriert. Rasse ist ein Begriff, historisch in einem Feld von anderen Begriffen positioniert, die manchmal metonymisch eingesetzt werden: wie etwa Volk oder Nation und im Rahmen der Neuformierung eines kulturalistisch argumentierenden Rassismus, um zum Beispiel die angebliche Bedrohung Europas durch den Islam zu behaupten. Hier treten religiöse Narrative hinzu. Klassifizierungs- und Wertungssysteme, in denen bestimmte Rassen anderen per se überlegen sind, liefern zugleich soziale Anordnungen: Rassevorstellungen plausibilisieren historisch tief verankerte, ebenso wie relativ neue Ungleichheiten in Bezug auf Reichtum, Bildung, Gesundheits- und Wohnungsversorgung, in Bezug auf Bürgerrechte, aber auch im Alltag und im Verhältnis zu Institutionen, zum Beispiel als Racial Profiling, sowie in fehlenden und verzerrten Repräsentationen in den Medien bis hin zu einer biopolitischen Unterscheidung danach, wessen Leben höheren Wert besitzt. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich einerseits um Humandifferenzierungen handelt und andererseits um genealogische Narrative, dann ist wichtig zu beachten, dass sie in eine gesellschaftliche Anordnung gebracht werden, die in Diskursen, alltäglichen Praktiken, sozialen Institutionen und Infrastrukturen ausgearbeitet und zum Teil gewaltvoll umgesetzt werden. In verschiedenen Traditionen der Rassismustheorie wird deswegen von strukturellem oder systemischem Rassismus gesprochen. Daher reicht es nicht, um gegen Rassismus zu sein oder routinemäßig zur Verteidigung von Demokratie gegen die rechtsextreme Gefahr aufzurufen. Kulturen und Strukturen des Rassismus zu unterlaufen und zu delegitimieren, ist eine schwierige und große gesellschaftliche Aufgabe.
Die Ermordung von George Floyd im Jahr 2020 durch einen weißen Polizeibeamten in den USA löste auch in Deutschland enorme Proteste und Debatten um Rassismus aus. Gab es in der Bundesrepublik bereits davor einen ernsthaften Diskurs über Rassismus?
Schon seit Jahrzehnten. Die Verknappung des Diskurses über Rassismus in vielen wissenschaftlichen Feldern war in Deutschland lange Zeit eklatant. Schon der Begriff Rassismus wurde meist gemieden, galt er doch vielen als unsachlich und unwissenschaftlich. Eine Aufweichung dieser ablehnenden Haltung in der Öffentlichkeit ebenso wie in den Wissenschaften folgte sukzessiv und erst nach der im Jahr 2011 aufgedeckten Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds bzw. des Komplexes, der die Aktivität dieses Terrornetzwerkes getragen hatte. Bei der Gedenkfeier, die von Angehörigen der Mordopfer gefordert worden war und im Februar 2013 in Berlin stattfand, sprach die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel als eine der ersten Politikerinnen in einem hohen Amt explizit von Rassismus. Nach den antisemitischen und rassistischen Anschlägen in Halle im Oktober 2019 und Hanau im Februar 2020 wurde dann von der deutschen Bundesregierung ein Kabinettsausschuss gebildet und schließlich sind wir jetzt in einer neuen Situation, in der es zu einer etablierten und hoffentlich sich etablierenden neuen und kritischen Rassismusforschung kommt. Die historische Entwicklung der Rassismustheorien in der Bundesrepublik habe ich 2016 in einem kleinen Projekt mit meinen Kollegen Benjamin Opratko und Manuel Liebig, beide inzwischen an der Universität Wien, untersucht. Wir haben dabei die Geschichte der Rassismusforschung in Deutschland als Desiderat festgehalten und geprüft, ob es Bezüge zwischen der Antisemitismus- und der Rassismusforschung gibt. Wir fanden damals schon, dass diese Forschungen gegeneinander ausgespielt werden. In manchen Diskursen wurde suggeriert: Weil es so viel Antisemitismusforschung gegeben habe, sei zu wenig über Rassismus geforscht worden. Ich halte das für falsch und denke, dass es gerade in den Zusammenhängen der Antisemitismusforschung zu den ersten wirklich guten und kritischen Forschungen zu Rassismus gekommen ist, u. a. am Hamburger Institut für Sozialforschung und am Frankfurter Institut für Sozialforschung.
Und wie würden Sie mit Blick auf Ihre Projektergebnisse die spezifische Entwicklung der Rassismusforschung in Deutschland beschreiben?
Alle Forschenden, mit denen wir Interviews geführt haben und die zum Teil bereits seit Jahrzehnten Rassismusforschung betrieben haben, gaben als Motivation an, dass ihr Leben und ihre Erfahrung in Deutschland sehr stark geprägt sind von der Geschichte und der Haltung gegen den Nationalsozialismus, gegen den Holocaust, gegen den Antisemitismus und dass das eine ihrer zentralen, auch biografischen Motivation darstellte, die Rassismusforschung voranzutreiben. Die Rassismusforschung war zu jenem Zeitpunkt schwach institutionalisiert und fand sehr wenig Resonanz im wissenschaftlichen Feld sowie in den gesellschaftlichen und politischen Sphären. Nach dem sogenannten „ Sommer der Migration“ 2015 kam es zu einer Kultur des Willkommenheißens gegenüber Geflüchteten, zeitgleich nahmen aber auch rassistisch motivierte Gewalttaten wieder zu: Hate Speech, ein Rechtsruck politischer Diskurse, Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte und Geflüchtete usw. Eine erstarkende Ablehnungskultur, so nennen wir das in einem transnationale Forschungsprojekt manifestierte sich spätestens nach 2016 und die Abwehrhaltung wurde nicht nur gegenüber Geflüchteten und Migrant*innen deutlich, sondern auch in rassistischen Übergriffen und Anschlägen sowie in der Unterstützung rechter Bewegungen und Parteien. Bundesweiten politischen Ausdruck erfuhren diese in der kontinuierlichen Demonstration von Pegida und ihren lokalen Ablegern, in der um sich greifenden Präsenz neuer rechter Argumentationen in den sozialen Medien sowie in politischen Diskursen, schließlich sich institutionalisierend durch den Einzug der AfD in den Bundestag im September 2017 und dann während der Corona-Proteste. Die schwache gesellschaftliche Verankerung von fundiertem Wissen über Rassismus, ebenso wie die Weise, wie rechtsextreme Parteien und Bewegungen öffentlich kommentiert wurden, hat dazu geführt, dass Menschen sehr häufig rassistischen Ideologien und Diskursformen aufgesessen sind. Doch die kritische Rassismusforschung geht davon aus, dass Rassismus nicht hinreichend ausschließlich als Rechtsextremismus, als individuelle Eigenschaft oder subjektives Reaktionsmuster verstanden werden kann. Es handelt sich um ein dynamisches Feld, in dem politische Ideologien, Staatshandeln, institutionelle Regeln, kulturelle Codes, ökonomische Strategien, sozialpsychologische Einstellungen und verkörperte Routinen unter den Bedingungen sozialer Ungleichheit auf lokaler, nationaler und transnationaler Ebene zusammenfinden und sich historisch veränderbar rekonfigurieren. Das Wissenschaftsfeld der Rassismusforschung ist in dieser Gemengelage von großer Bedeutung. Es ist darauf ausgelegt, die Zusammenhänge dieser Facetten, ihre Widersprüche und Transformationen zu analysieren. Doch die durchaus vorhandenen Wissensbestände, Forschungstraditionen und begrifflichen Definitionen sind weithin unbekannt, und zwar sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch in der wissenschaftlichen Rezeption. Denn der Rassismusforschung in Deutschland fehlt es an Orten der Institutionalisierung und Kanälen der Überlieferung, jedenfalls bis vor Kurzem.
Wie lässt sich die historische Entstehung der Rassismusforschung in Deutschland skizzieren?
Für die öffentliche Behandlung des Themas Rassismus war in Deutschland lange Zeit eine zeitliche, soziale und räumliche Verschiebung charakteristisch. Rassismus wurde zeitlich verschoben, indem Rassismus an die historischen Erscheinungsformen der nationalsozialistischen Rassenpolitik gebunden wurde. Dadurch wurde Rassismus zu einem Problem der Vergangenheit erklärt. Damit verbunden fand häufig eine soziale Verschiebung des Rassismus in den Rechtsextremismus statt, Rassismus wurde als Problem sozialer Ränder definiert. Die räumliche Verschiebung meint, dass Rassismus als Problem ehemaliger großer Kolonialmächte wie Großbritannien und Frankreich behandelt wurde, unbenommen der deutschen Beteiligung an diesen kolonialen Projekten, oder als Problem der USA oder Südafrikas als rassistische Länder. Eine Rassismusanalyse mit kritischem Blick auf die eigene gegenwärtige Einwanderungsgesellschaft in ihrer Gesamtheit hat, von einzelnen historischen Ausnahmen abgesehen, eine kurze Geschichte in Deutschland. Die fast vier Jahrzehnte der Rassismusforschung in Deutschland waren geprägt von hoher Prekarität, es handelte sich um stark fragmentierte und kaum organisierte Zusammenhänge. Die sich seit den 1970er-Jahren konsolidierende kritische Rassismusforschung in Deutschland lässt sich auf eine spezifische historische Konstellation in den 1980er-Jahren zurückführen, in der gesellschaftspolitische Impulse mit einer punktuellen wissenschaftlichen Internationalisierung zusammengetroffen sind. Dies betrifft vor allem die Folge der Selbstorganisierung ehemaliger Gastarbeitender und Geflüchteter sowie Diskussionen in feministischen, migrantischen und Schwarzen Bewegungen. In diesem Zusammenhang gab es einen inhaltlichen Austausch sowie Übersetzungsarbeit, insbesondere aus der britischen und französischen Rassismus-Diskussion. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung bildete der von Annita Kalpaka und Nora Räthzel organisierte Kongress „Rassismus und Migration in Europa“, der 1990 in Hamburg mit über 1.000 Teilnehmenden und Beiträgen internationaler Rassismusforscher*innen stattfand und mehrfach in den Interviews, die wir geführt haben, als Initialzündung für die Rassismus-Diskussion in Deutschland genannt wurden. Als die rassistischen Pogrome sowie der mediale und politische Umgang das Thema zu Beginn der 1990er-Jahre auf die politische Tagesordnung setzten, existierten bereits Ansätze einer international vernetzten Rassismusforschung. Die Explosion rassistischer Gewalt diente gleichsam als Forschungsfeld und führte zur Ausweitung und Ausdifferenzierung der Rassismusanalyse. Doch die Rassismusforschung in Deutschland blieb in den folgenden Jahren weitgehend ereignisgetrieben: Zu nennen sind die Anschläge und Pogrome Anfang der 1990er-Jahre sowie die damit verknüpfte Asylrechtsdebatte, die Terroranschläge vom 11. September 2001 und der folgende globale „Krieg gegen den Terror“. Die Narrative eines Kampfs der Kulturen waren auch in Deutschland wirkmächtig. 2010 hielten mit der Debatte um Sarrazins Veröffentlichung von "Deutschland schafft sich ab" neue Verknüpfungen von sozial-kulturalistischen und biologistischen Begründungsmustern Einzug in den gesellschaftlichen Mainstream; schließlich folgte die bereits erwähnte Selbstenttarnung des NSU und die damit zusammenhängende Kritik an strukturellem und institutionalisiertem Rassismus. Das sind aber jetzt wirklich nur die großen Instanzen.
Wie kann man dann das Feld der Rassismusforschung gut abstecken oder definieren, vor allem auch im Vergleich zur Rechtsextremismusforschung?
Rassismus muss als gesellschaftliches Phänomen insgesamt untersucht werden, das in allen gesellschaftlichen Spektren und Selbstzuordnungen artikuliert werden kann. Rassismus versteht sich nicht als konfliktives Verhältnis zwischen Zugewanderten und Einheimischen und rahmt ihn auch nicht als Problem der mangelhaften Einpassung von „Fremden“ in einer Aufnahmegesellschaft. Darum ist auch jede Forschung vergeblich, die allein auf eine umgekehrte Promotion der »Fremden« setzt. Rassismusforschung verweist auf die alltäglichen und institutionellen Dimensionen des Rassismus, lenkt den Blick auf Ein- und Ausschließungspraktiken, auch innerhalb einer pluralen und liberalen Gesellschaft, und fragt danach, wer oder was unter welchen Bedingungen als fremd und anders definiert wird. Rassismusanalyse untersucht also nicht Rassismus als pathologischen Teilbereich von Gesellschaft, sondern nimmt in den Blick, wie Gesellschaft durch Rassismus mit konstituiert wird. Rassismusforschung geht es nicht um Fremdenfeindlichkeit, wenn damit unterstellt ist, dass evident sei, wer wo wann und wie als fremd gilt. Rassismusforschung ergründet vielmehr, wie das Fremdsein hergestellt wird und welche Essentialisierung, also positive oder negative kollektiv wesenhafte Zuschreibung, den fremden Figuren aufgeherrscht und in Genealogien gepresst wird. Die Ausgestaltung der Figuren ist dabei historisch und gegenwärtig höchst variabel, ohne sich von der Geschichte ihrer Unterdrückung jemals zu weit zu entfernen. Insofern nimmt Rassismusforschung für sich in Anspruch, jeweils spezifische Rassismen in jeweils historisch zu bestimmenden Situationen und Konstellationen als Teil ihres Gegenstandbereiches zu verstehen. Dies auch, wenn wissenschaftshistorische oder strategische Gründe für separate Bezeichnungen sprechen, zum Beispiel Antiziganismus, Islamophobie oder Antisemitismus. Der übergeordnete Begriff Rassismus erlaubt eine systematische und vergleichende Perspektive auf unterschiedliche Rassismen, ermöglicht die Übertragung theoretischer Erkenntnisse, zum Beispiel aus der Antisemitismusforschung oder der Erforschung des Kolonialrassismus, öffnet den Blick auf strukturelle Zusammenhänge verschiedener Rassismen und kann den notwendigen Austausch über wissenschaftliche Disziplinen und Theorieschulen hinweg antreiben. Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis zu verstehen bedeutet auch, jene in diese Analyse einzubeziehen, die sich in diese Verhältnisse zumeist als unmarkierte Norm rechnen können. In sich unter dem Druck der Globalisierung veränderter Arbeits- und Lebensverhältnisse, die andere Angebote symbolischer und materieller Vergemeinschaftung prekär werden lassen, kann ein Investment in, ich zitiere, die „rassistische Gemeinschaft“ besondere Attraktivität entfalten. Rassistische Ideologie bietet Zusammenhalt und sozial kulturellen Kitt. Auch damit muss man sich auseinandersetzen, wenn man über sozialen Zusammenhalt forschen will – besonders da, wo gesellschaftliche Verteilungskämpfe schärfer werden und sich wandelnde Migrationsgesellschaften dynamisch das bestehende rassistische Zugehörigkeitsmanagement unter Druck setzen oder auch bestimmte Gruppen zu integrieren bereit sind, weil sie sich als verdient erweisen oder als nützlich gelten. Da Rassismen Konjunkturen unterliegen, müssen ihre Funktionsweisen und Dynamiken stets aufs Neue bestimmt werden.
Welche gegenwärtigen Konjunkturen von Rassismen und Dynamiken sehen Sie momentan als wichtige Fragen für die Rassismusforschung?
Die neuen autoritären rechten Bewegungen und Parteien und die zugehörigen Kulturen stellen zentrale Fragen an die Forschung. Dabei geht es darum, inwiefern diese rechtsextremen Bewegungen und Parteien über ihren unmittelbaren Wirkungskreis hinaus das Feld des Sagbaren insgesamt verschieben. Hier ließe sich aus rassismuskritischer Sicht an Ergebnissen der Forschung zur neuen Rechten anschließen, die seit den 1980er-Jahren existiert sowie an die kritische Diskursanalyse und natürlich an die Rechtsextremismusforschung, die zum Beispiel von einer „enthemmten Mitte“ spricht. Zudem ist der Zusammenhang zwischen ökonomischen Krisenerfahrungen und rassistischer Mobilisierung aus meiner Sicht bisher noch nicht ausreichend verstanden. Der Zusammenhang, der oft als These von den „Globalisierungsverlierer*innen“ formuliert wird, zuletzt auch der „Globalisierungsangst“, wird angenommen, aber viel zu selten empirisch untersucht. Er ist damit unklar und die Analyse der Diskurstaktiken und Sprachpolitiken der neuen rechten Formation im Hinblick auf die aktuellen Metamorphosen des Rassismus müssen untersucht werden. Das betrifft das Auftreten in der Öffentlichkeit und insbesondere aus meiner Sicht in den Onlinemedien – und vermittels technologischer Infrastrukturen. Dabei geht es nicht nur darum, was in diesen Medien gesagt wird. Die computerisierten Infrastrukturen tragen selbst zu diesen Verschiebungen bei. Ein weiterer Punkt ist das Verhältnis von Geschlechterverhältnissen und Rassismus, die ihrer Untersuchungen ganz dringend harren, also die Weise, in der Rassismus auch durch bestimmte Geschlechtsnormierung reproduziert wird, etwa in der Ausländer- und Migrationsgesetzgebung. Eine andere Frage betrifft die historischen Voraussetzungen aktueller Rassismen. Hier ist der Zusammenhang von Antisemitismus- und Rassismusforschung besonders relevant. Wichtig ist auch der Alltagsrassismus, der weiter und besser verstanden werden muss, insbesondere sollten die Stimmen gehört werden, die von Rassismus in besonderen Weisen betroffen sind. Ein weiterer Punkt ist der institutionelle Rassismus. Und schließlich die Frage, ob und inwiefern sich Deutschland neu aufstellen wird in Bezug auf die Fragen von Migration und auf Asyl, denn es kam in den letzten Jahren zu Neudefinitionen des rechtlichen Status auf der Grundlage von Herkunftsländern, die in rassismustheoretischer Hinsicht problematisch sind. In Deutschland werden die globalen Zusammenhänge in Bezug auf Rassismus und überhaupt Deutschlands Rolle innerhalb Europas, aber auch der Welt unterschätzt. Hier liegt ein wichtiger Punkt, um über die Veränderungen von Rassismus und insbesondere, aber nicht nur, dem Klimawandel nachzudenken. Wir haben es nicht nur mit einem deutschen, sondern globalen Phänomen zu tun, das sich aber global neu zusammensetzt und wo sehr viel Übersetzungs- und Vermittlungsarbeit geleistet werden muss, um gemeinsame Denk- und Forschungsräume zu eröffnen; wenn wir an die Ablehnung von Migration denken, ist das nicht nur in Deutschland der Fall, sondern wir sehen das zum Beispiel auch an der polnisch-belarussischen Grenze. Wir müssen unbedingt zum Verhältnis Gesundheitspolitik und Rassismus arbeiten. Und zuletzt: Wir brauchen eine intensive Arbeit an einer Vision einer antirassistischen und solidarischen Gesellschaft – einer Gesellschaft, deren Solidarbeziehungen gerade nicht auf der Spaltung der Menschheit durch Rassismus beruhen. Damit hätten wir einen großen Beitrag gegenüber einer Forschung geleistet, die an komplexen Fragen des sozialen Zusammenhalts in einer globalen Welt interessiert ist.