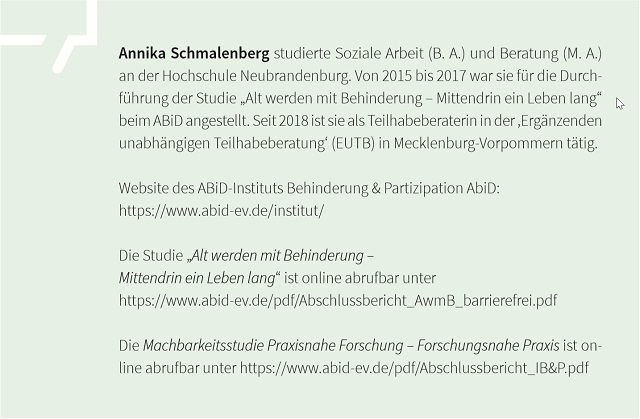Janine Dieckmann:
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen. Sie waren Mitautorin der Studie „Alt werden mit Behinderung – Mittendrin ein Leben lang“ des Allgemeinen Behindertenverbands in Deutschland (ABiD) in Kooperation mit der Alice-Salomon-Hochschule. Was genau ist der ABiD?
Annika Schmalenberg:
Der ABiD ist der Bundesverband, der aus Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderungen besteht, auch auf politischer Ebene. Er ist nach der Wende im Gebiet der neuen Bundesländer entstanden und gründete sich in mehreren Landesverbänden, die sich dann wiederum eigenständig strukturieren und organisieren, aber unter dem Dach des ABiD zusammenlaufen. Der ABiD selbst ist aber jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte als Interessenvertretung auch in verschiedenen Gremien aktiv, z. B. im deutschen Behindertenrat, und wirkt mit Initiativen und Stellungnahmen im Interesse der Menschen mit Behinderungen und natürlich auch ihrer Angehörigen, Freunde, Nachbarn und Bekannten – also alle, die zum sozialen Umfeld gehören – auf die Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen hin. Überwiegend ist er dabei in den neuen Bundesländern mit den unterteilten Landesverbänden vertreten, ist aber durch Kooperationen und stellenweise auch in den alten Bundesländern aktiv. Der ABiD pflegt auch internationale Netzwerke, Kooperationen und Partnerschaften in die Gebiete und Länder nach Osteuropa. Das ist historisch gewachsen und wahrscheinlich auch aus persönlichen Kontakten heraus entstanden.
Janine Dieckmann:
Wie kam es für die Studie „Alt werden mit Behinderung“ zur Kooperation mit Frau Professorin Swantje Köbsell von der Alice-Salomon-Hochschule?
Annika Schmalenberg:
Hintergrund der Kooperation zwischen dem ABiD und der ASH damals war, dass man Interviews mit einem oder einer Studierenden der ASH und einem Menschen mit Behinderung durchführen wollte, die dann gemeinsam losziehen und andere Menschen mit Behinderung interviewen. Die Grundidee war, dass der Mensch mit Behinderung einen ganz anderen Zugang zu dem Befragten hat, aufgrund der ähnlichen Lebenserfahrung als der Student ohne Behinderung. Wiederum kannte sich der Student ohne Behinderung besser mit den wissenschaftlichen Aspekten der Interviewführung und Interviewgestaltung aus. Frau Professorin Köbsell hatte damals die wissenschaftliche Leitung der Studie inne. Das war ja das erste Mal, dass sich der ABiD an so ein Vorhaben herangetraut hat.
Janine Dieckmann:
Was war das Ziel der Studie „Altwerden mit Behinderung“?
Annika Schmalenberg:
Die Studie wollte eigentlich in den Fokus rücken, wie es Menschen mit Behinderung im Alter gelingt, gesellschaftliche Teilhabe auch weiterhin aufrechtzuerhalten – was sie dafür benötigen, wie die strukturellen Bedingungen dafür sind. Wir wollten untersuchen, wie gesellschaftliche Teilhabe mit Behinderung bis ins hohe Alter gelebt wird, wie sie empfunden wird und welche strukturellen Gegebenheiten es dafür braucht. Von diesem Fokus wurde relativ schnell etwas abgerückt, weil wir in den Interviews gemerkt haben, dass die befragten Personen ganz andere Sorgen und Nöte hatten, als jetzt über ihre Teilhabe zu sprechen. Es ging ihnen vordergründig um Versorgungslücken und Versorgungsdefizite zur ganz einfachen Alltagsgestaltung. Also wirklich so banale Dinge: Wie komme ich morgens aus dem Bett und wer hilft mir übermorgen, wenn ich zu meinem Kühlschrank gehe und wieder einkaufen muss. Das waren für viele Befragte existenzielle Sorgen und Nöte, die dann in den Interviews vermehrt angesprochen wurden. Anders als solche Sachen wie: Wann kann ich das nächste Mal ins Theater gehen, weil das in dem Moment, ich will nicht sagen nicht so wichtig war, aber weniger wichtig als: Wie kriege ich meinen Kühlschrank wieder voll? Deswegen ist leider der ursprüngliche Fokus in den Hintergrund gerückt.
Janine Dieckmann:
Sie haben in der Studie ja auch einen Stadt-Land-Vergleich angestellt. Sie haben intensiv versucht, Menschen im ländlichen Raum zu interviewen. Welche Ergebnisse haben sich in diesem Vergleich gezeigt?
Annika Schmalenberg:
Ja, dieses Thema konnte tatsächlich nur etwas angekratzt werden, also der Vergleich zwischen ländlicher Region und städtischen Strukturen, weil wir überproportional viele Probanden aus dem städtischen Raum hatten. Wir haben die Unterscheidung anhand der Einwohnerzahl gemacht. Ob jemand auf dem Dorf lebt, also bis 3.000 Einwohner. Dann gab es die Kleinstadt, 3.000 bis 5.000 Einwohner, und dann städtische Strukturen ab 5.000 bis hin zu Großstädten. Tatsächlich Befragte aus dem ländlichen Raum, also Dorf oder Kleinstadt, das waren dann leider relativ wenige – 18 von damals über 60 Befragten. Was wir festgestellt haben war, dass in ländlichen Gebieten häufig familiäre und nachbarschaftliche Netzwerke mehr ausgebaut waren als in städtischen Strukturen. Dort waren diese auch vorhanden, haben aber nicht immer unbedingt zum Unterstützungsnetzwerk der Menschen mit Behinderungen gezählt. In dörflichen Regionen wurde eher darauf zurückgegriffen und weniger auf professionelle Dienste. Das waren aber jetzt Themen, die weniger die gesellschaftliche Teilhabe, sondern auch wieder die Alltagsversorgung betreffen.
Janine Dieckmann:
Im ländlichen Raum findet für Menschen mit Behinderung also mehr Nachbarschaftshilfe statt?
Annika Schmalenberg:
Das war tatsächlich damals eine Verbindung, die wir in der Studie knüpfen konnten. Es wurde berichtet, dass Versorgungsstrukturen noch mehr auf familiäre und nachbarschaftliche Strukturen zurückgreifen, als dies in Großstädten zu finden ist. Dort wurde zwar auch darüber berichtet, aber proportional anhand der Zahlen der Befragten war es doch in ländlichen Strukturen häufiger; zum Beispiel bei Umbauarbeiten in der Wohnung, die wurden im ländlichen Raum eher von familiären Netzwerken geleistet als in der Stadt. Dort wurden eher professionelle Angebote in Anspruch genommen.
Janine Dieckmann:
Gibt es spezifische Probleme im ländlichen Raum für Menschen mit Behinderung oder sind es die gleichen wie in der Stadt, vielleicht nur in größerem Ausmaß?
Annika Schmalenberg:
Fehlende Barrierefreiheit ist ein großes Thema im ländlichen Raum. Je peripherer die Region, desto schwieriger ist es, barrierefrei von A nach B zu kommen, zum Beispiel in Kultur- und Veranstaltungszentren bzw. sind diese dann erst in den nächsten größeren Städten, sodass das ländliche Leben wenig ausgebaut ist. Aber in ländlichen Strukturen gibt es einfach Probleme, Teilhabe zu leben, die aber auch Menschen ohne Behinderung treffen. Also sei es beispielsweise die geringe Anzahl von Möglichkeiten der Unternehmungen oder Probleme im öffentlichen Nahverkehr, weil die Verbindungen so schwach ausgebaut sind. Dazu kommen dann natürlich wieder behinderungsspezifische Sachen, nämlich dass ein Mensch mit Behinderung zusätzliche Aspekte der Barrierefreiheit in diesen Bereichen benötigt. Das sind alles Sachen, die sind in einer Großstadt besser und häufiger ausgebaut, sodass einfach generell viel mehr Möglichkeiten existieren. Unsere Studie hat gezeigt, dass Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderung im ländlichen Raum häufiger von Treppenstufen berichten, die ihnen die Wohnsituation erschweren, vor allem in alten Häusern. In den Städten berichteten sie weniger von Treppen, aber von schweren Türen, die sich nicht allein aufbekommen. Also es gibt auch ein paar Unterschiede in den Bedarfen.
Janine Dieckmann:
Beim Thema Barrierefreiheit denkt man als erstes an Rampen für Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer, aber an was denken Sie noch, wenn Sie an Barrierefreiheit im ländlichen Raum denken?
Annika Schmalenberg:
Barrierefreiheit ist ja etwas, das nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkung betrifft, sondern genauso Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen oder mit kognitiven Beeinträchtigungen. Klar, man denkt immer symbolhaft an die Rampe für Rollstuhlfahrer, aber es geht genauso darum, z. B. für Menschen mit Hörbehinderung spezielle akustische Gegebenheiten vor Ort zu schaffen, damit sie an einer Lesung oder einer Theatervorstellung teilnehmen können. Seien es im Fußboden verlegte Induktionsschleifen oder Schriftdolmetscher, Gebärdendolmetscher usw. Da gibt es mehrere Sachen, die man organisieren könnte. Für Menschen mit andere Sinnesbehinderungen ist es natürlich wieder ein ganz anderer Bedarf, der zugrunde liegt – sei es hinsichtlich der Orientierung, irgendwo hinzukommen, sich in Räumlichkeiten zurechtzufinden oder zugängliche Informationsmaterialien zu haben. Auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen kann es Unterstützung hinsichtlich der Barrierefreiheit geben. Das sind zum Beispiel Auskünfte in leichter Sprache oder Piktogramme, die irgendwas erklären, ohne dass man komplizierte Sachverhalte lesen muss. Also es ist wichtig, den Begriff der Barrierefreiheit relativ groß zu fassen. Es fängt häufig mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer an, aber leider ist das nicht ausreichend.
Janine Dieckmann:
Wie schätzen Sie die Teilhabemöglichkeiten im ländlichen Raum von Menschen mit Behinderungen ein? Was tut sich in Richtung Barrierefreiheit?
Annika Schmalenberg:
Es gibt natürlich Behindertenverbände, Interessenvertretungen und die Vereine dazu, die das Thema der Barrierefreiheit immer wieder ansprechen und in den Fokus nehmen. Die sind da eigentlich die treibenden Kräfte, die sagen: Wir brauchen aber diese und jene Gegebenheiten für die Barrierefreiheit. Bei uns im Landkreis haben wir zum Beispiel einen Kreisbehindertenrat, der eine Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Verwaltung und Kommunalpolitik ist. Dieser Kreisbehindertenbeirat soll auch darauf hinwirken, dass der ÖPNV bei uns barrierefrei wird. Würde es den Kreisbehindertenrat nicht geben und würde er das nicht gemeinsam mit den Interessenvertretungen aus eigener Kraft stemmen, also den „Finger draufhalten“ und sagen: ‚Wir müssen da jetzt aber auch mal was bauen‘ und ‚Wir müssen daran denken‘, dann würde da von alleine nichts passieren. Ohne die Eigeninitiative von Selbstvertretungen wäre das Thema Barrierefreiheit noch schwieriger, als es sowieso schon ist. Aber das ist leider überall zu beobachten, nicht nur im ländlichen Raum. Aber es ist hier nochmal ein besonderes Thema, z. B. im öffentlichen Nahverkehr: Es braucht einen barrierefreien Bus im Dorf XY, auch wenn vielleicht ein Mal im Jahr ein Rollstuhlfahrer einsteigt. Dann ist das aber genau das, was dieser Rollstuhlfahrer in dem Moment braucht. Und wenn an allen anderen Tagen keiner mit einem Rollstuhl einsteigt, dann ist es trotzdem gut, einen Niederflurbus zu haben und diesen durchgesetzt zu haben. Barrierefreiheit ist nicht nur etwas, was für Menschen mit Behinderung notwendig ist. Es ist etwa für Eltern mit Kinderwagen, die ebenfalls die Rampe benutzen, oder für die ältere Generation hilfreich. Wichtig wäre es, diesen Denkprozess in der Gesellschaft umsetzen zu können, dass es nicht immer heißt: Barrierefreiheit ist nur für Menschen mit Behinderung.
Janine Dieckmann:
Ich habe den Eindruck, dass Menschen mit Behinderung allgemein wenig im Denkprozess der Gesellschaft stattfinden bzw. losgelöst von anderen Diskursen über gesellschaftliche Teilhabe. Warum ist es wichtig, mehr die Perspektive von Menschen mit Behinderung mit zu denken?
Annika Schmalenberg:
Naja, das Warum ist immer so eine Sache. Ich frage dann immer: Warum nicht? – Denn sie ist ein Teil der gesellschaftlichen Perspektive und warum sollte man sie ausklammern? Eine Begründung dafür zu finden, ist immer wie eine Art Rechtfertigung und eigentlich muss man sich nicht rechtfertigen. Der inklusive Gedanke geht davon aus, dass es einfach dazu gehört. Es ist aber einfach so, dass dieses Bild von Behinderung noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Angenommen man würde Person XY auf dem Marktplatz fragen: Haben sie jemanden in ihrem sozialen Umfeld, der eine Behinderung hat? Ich weiß nicht, wie viele Leute dann „ja“ sagen würden und von denen würden wenige sagen: ‚Ja, ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt‘. Wir erleben in Berichten immer wieder, dass Menschen mit Behinderung als Novum wahrgenommen werden. Aus der Historie ist dieses medizinische Bild der Behinderung gewachsen: Menschen mit Behinderung müssen unterstützt, gepflegt, versorgt, umsorgt werden. Das gesellschaftliche Bild war nicht so, dass sie selbstbestimmt, eigenverantwortlich und autonom sind als Individuum. Heute gehen wir aber eher von der menschenrechtlichen Perspektive, von der sozialen Perspektive auf Behinderung aus, und dass Behinderung auch ein gesellschaftliches Problem ist. Dieser Wandel ist aber einfach noch nicht angekommen. Menschen mit Behinderung sind wie jeder andere gleichwertig. Deswegen muss ich nicht darüber nachdenken, ob ich da jetzt eine Rampe baue oder nicht. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist aktuell zehn Jahre alt geworden. Als diese verabschiedet wurde, dachten wir: ‚Ja, vielleicht tut sich dieser Schritt ja von heute auf morgen.‘ Aber nein – es war ein stetiger Prozess und wird auch die nächsten Jahre ein stetiger Prozess sein. Es gibt diverse Bereiche, wo Deutschland hinterher hängt, sei es im Schulsystem oder im Bereich der Arbeit.
Janine Dieckmann:
Im Anschluss an die erste ABiD-Studie gab es noch eine weitere. Sie waren Mitautorin dieser „Machbarkeitsstudie“ des ABiD. Worum ging es?
Annika Schmalenberg:
Die Studie „Alt werden mit Behinderung“ hatte gezeigt, dass es dort viele Themen gab, die nicht ausreichend beforscht werden konnten. Wir hatten am Ende einen bunten Blumenstrauß an Themen, zu denen man ganz eigene Forschungsvorhaben aufmachen müsste. Daraufhin fragte sich der ABiD: Wie könnten wir uns diesen offenen Fragen annehmen? Welche Struktur braucht es dafür? Daraufhin kam die Idee für ein eigenes Forschungsinstitut. Die „Machbarkeitsstudie“ sollte u. a. herausfinden: Wenn der ABiD diesen Weg in Zukunft gehen möchte, also sich in Zukunft immer wieder Forschungsthemen anzunehmen, was muss dieses Institut leisten? Wie muss es strukturiert sein? Welches Alleinstellungsmerkmal hätte es? Wie sieht die Forschungslandschaft im Bereich der Teilhabeforschung aktuell aus, um sich selbst besser verorten zu können?
Janine Dieckmann:
Was kam bei der Selbstverortung in der Teilhabeforschung heraus?
Annika Schmalenberg:
Wir haben uns vorrangig auf den deutschsprachigen Raum bezogen und in Deutschland ist die Teilhabeforschung vor allem in den letzten Jahren in starker Entwicklung. Es haben sich verschiedene Zentren zur Teilhabeforschung gegründet oder z. B. auch das Aktionsbündnis Teilhabeforschung, sodass wir uns im ersten Teil einen Überblick verschafft haben: Was gibt es? Und wie arbeiten die vorhandenen Forschungsstrukturen? Manche sind an akademische Strukturen angebunden, also: Was sind da die Grundlagen? Teilhabeforschung kann auf verschiedenen Stufen der Partizipation stattfinden, d. h., wie stark beziehe ich z. B. die betroffenen Gruppen dort mit ein? Haben sie überhaupt Mitgestaltungsmöglichkeiten? Und wenn ja, wie stark? Werden sie nur befragt? Können sie beratend tätig sein? Können sie selbst Entscheidungsprozesse bei diesen Forschungsvorhaben initiieren? Können sie vielleicht sogar ganze Forschungsvorhaben selbst steuern und durchführen? Das sind Stufen der Partizipation in der Teilhabeforschung.
Deutlich wurde, dass es immer wieder kooperative Studien zu Menschen mit Behinderung gibt – wo man als Kooperationspartner mit akademischen Strukturen zusammenarbeitet. Aber dass die Initiative, ein Forschungsvorhaben zu Menschen mit Behinderung voranzutreiben, ausschließlich durch eine Interessenvertretung beauftragt und organisiert wird und wiederum der Kooperationspartner einer Universität oder Hochschule ist, das gab es nur sehr selten oder punktuell. Dazu gab es immer mal wieder einzelne Projekte und das war dann auch das Ziel mit dem Institut vom ABiD, nämlich zu sagen: ‚Okay, die Interessenvertretung, die leitet die Forschung, sie steuert diese und koordiniert diese als Hauptakteur‘. Im zweiten Studienteil haben wir eine kleine Befragung durchgeführt. Wir wollten Menschen mit Behinderung, Angehörige und das soziale Umfeld erreichen. Mit wenigen Fragen wurde abgefragt, was die Menschen unter Teilhabe verstehen, welche Gegebenheiten es für Teilhabe braucht, welche Themen der Teilhabeforschung sie als relevant empfinden usw. Daraus wurde der Forschungsbedarf für das Institut abgeleitet. So sollten zum Beispiel auch die ländlichen Strukturen und ihre Gegebenheiten intensiver in den Blick genommen werden.
Janine Dieckmann:
Und seit wann gibt es das ABiD-Institut?
Annika Schmalenberg:
Gegründet hat es sich im April 2018 als angegliedertes Institut an die Alice-Salomon-Hochschule. Neben der engen Kooperation zwischen Selbstorganisation und Wissenschaft war dabei auch der Hintergrund, es institutionell vom ABiD als Verein und seiner Tätigkeit zu trennen, denn auch wenn es natürlich vom ABiD initiiert ist, muss man aufpassen, dass Forschung neutral bleibt. Die Forschungsstruktur und die der politischen Interessenvertretung müssen also voneinander getrennt werden.
Janine Dieckmann:
Ich danke Ihnen herzlich für das Interview.
Annika Schmalenberg:
Vielen Dank.