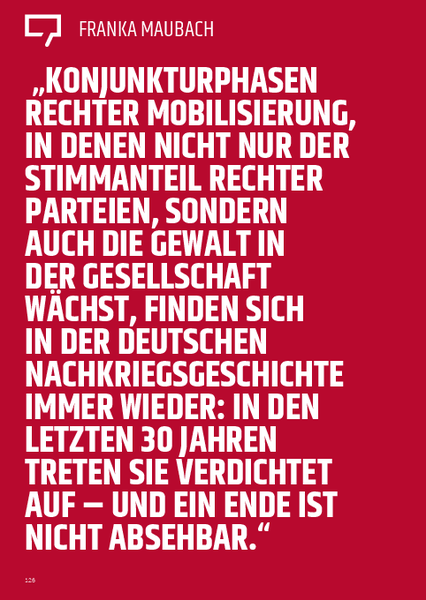Allerspätestens seit den Morden von Hanau kann man die Augen nicht mehr davor verschließen: Eine Welle rechter Gewalt geht über das Land. In ihrem Ausmaß lässt sie sich nur mit den zahllosen Übergriffen und Ausschreitungen Anfang der 1990er Jahre oder um 2000 vergleichen. Seitdem Pegida während und nach der „Flüchtlingskrise“ rassistische Ressentiments mobilisierte, Flüchtlingsheime und Geflüchtete angegriffen wurden und die AfD 2017 in den Bundestag einzog, folgten die Erschütterungen in immer rascherer Folge: Im Juni 2019 erschoss mutmaßlich ein rechtsradikaler Attentäter den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, im Februar 2020 starben in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte durch einen rassistischen Attentäter. Solche Konjunkturphasen rechter Mobilisierung, in denen nicht nur der Stimmanteil rechter Parteien, sondern auch die Gewalt in der Gesellschaft wächst, finden sich in der deutschen Nachkriegsgeschichte immer wieder. In den letzten 30 Jahren treten sie verdichtet auf – und ein Ende ist nicht absehbar.
Von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen und der Politik wurden die Gewaltereignisse seit 1989/90 sorgfältig dokumentiert. Die Listen politisch motivierter Morde, im gegenseitigen Abgleich angelegt von der Amadeu Antonio Stiftung, der ZEIT oder der Bundesregierung, sind unterschiedlich lang, zeugen aber alle gleichermaßen von der Kontinuität der Gewalt im vereinigten Deutschland. Diese Kontinuitätslinie konnte bislang nicht durchbrochen werden, im Gegenteil wird sie immer sichtbarer – eine Chronik der Gewalt, in die immer neue Ereignisse aufgenommen werden müssen. Jenseits dieser Verzeichnung von Verbrechen steckt eine zeithistorische Untersuchung rechter Mobilisierung und rassistischer Gewalt nach 1945 aber in den Kinderschuhen (vgl. aber Frei et al. 2019). In Gesamtdarstellungen der deutschen Nachkriegsgeschichte etwa spielen diese Themen höchstens am Rand eine Rolle, ein kompaktes Forschungsfeld existiert nicht (vgl. Müller 2019). Konjunktur hatte das Thema in der Geschichtswissenschaft immer dann, wenn die Gegenwart nach historischer Einordnung verlangte: etwa um 1968, als die NPD in mehrere Landtage einzog, Anfang der 1980er Jahre, als Alltagsrassismus und rechter Terror um sich griffen, nach 1990, als pogromartige Ausschreitungen überall in Deutschland zu beobachten waren, oder um 2000, als nicht zuletzt die Reformen des Staatsbürgerschaftsrechts zu einer Mobilisierung von rechts führten. Daneben verdankt sich die gegenwärtig intensivierte Forschungstätigkeit im Kontext des weltweiten Erfolgs rechtspopulistischer Bewegungen nicht zuletzt der Selbstenttarnung des NSU 2011.
Ob sich der Trend verstetigen kann, wird sich erweisen müssen. Dafür sprechen zahlreiche Publikationen, aber auch all die Projekte, die gegenwärtig aus der Taufe gehoben werden, und neue Forschungszusammenhänge wie der 2019 am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF) gegründete „Zeithistorische Arbeitskreis Extreme Rechte“.1 Mittelfristig wird das Thema vermutlich – in der für die Zeitgeschichte üblichen nachholenden Entwicklung – auch in Handbüchern oder Gesamtdarstellungen deutscher Nachkriegsgeschichte stärkere Beachtung finden. Gerade das Wissen um die Konjunkturen rechter Mobilisierung in der deutschen Nachkriegsgeschichte kann dazu beitragen, das Feld zu stabilisieren und auf seine zentrale Bedeutung innerhalb der Zeitgeschichte hinzuweisen. Nicht zuletzt gilt es, eine Periodisierung rechter Zeiten in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu erarbeiten. An die Stelle von Gewaltchroniken und Ereignisdokumentationen müsste eine gesellschaftsgeschichtlich integrierte Perspektive treten, die Einzelereignisse in ihre zeitlichen Zusammenhänge einbettet. Nach den (Dis-)Kontinuitäten in der Geschichte rechter Bewegungen oder rassistischer Gewalt ist ebenso zu fragen wie nach politischen Praktiken, die sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt und milieuspezifisch etabliert haben. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Geschichte der Mobilisierung von rechts in breiten Bevölkerungsschichten zu richten. Denn die Tatsache, dass rechte Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein verbreitet sind, ist an sich kaum erstaunlich – das zeigte bereits die Sinus-Studie Anfang der 80er Jahre (Greiffenhagen 1980; s. auch die Mitte-Studien, Zick et al. 2019). Wie aber ist zu erklären, dass sie zunehmend offen, auch offen gewalttätig artikuliert und politisch wirkmächtig werden konnten?
Mobilisierung von rechts: Wählerstimmen und rechte Gewalt
Wir brauchen also eine Gesellschaftsgeschichte rechter Mobilisierung und rechter Gewalt nach 1945. Eine solche Geschichte müsste Ost und West systematisch zusammendenken, einen Bogen schlagen zu Alltagsrassismus, radikalnationalistischen Einstellungen und Praktiken, aber auch die Perspektive der Opfer konsequent einbeziehen. Integriert werden müsste außerdem die Geschichte erfolgreicher Gegenmobilisierungen wie der Lichterketten 1992 und bürgerschaftlicher Initiativen gegen rechts (das betont immer wieder: Quent 2019). Die Geschichte der radikalen Rechten darf nicht isoliert betrachtet und erforscht werden, nicht nur als Geschichte rechter Parteien und Bewegungen, Täter und Taten, nicht nur als Gegnergeschichte, sondern in gesellschaftsgeschichtlicher Erweiterung; erst so wird sie zu einem integralen Bestandteil der deutschen Nachkriegsgeschichte.
In den Blick zu nehmen wären also die „Vorgeschichte der Gegenwart“ (Doering-Manteuffel et al. 2016) und weniger die langen Kontinuitäten, die aus der NS-Zeit bis ins Heute reichen. Die Nachkriegsgeschichte rechter Ideologien und Bewegungen und vor allem der Mobilisierung von rechts muss nach eigenem Recht verstanden werden. Denn die gegenwärtige Mobilisierungsfähigkeit verdankt sich nicht zuletzt einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung der Rechten mit der bundesdeutschen Demokratie, die als Prozess einer höchst ambivalenten Anpassung verstanden werden kann. Schon in seinem berühmten Aufsatz Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? hatte Adorno „das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie“ betrachtet (hier zit. nach Frei et al. 2019: 35). 1967 argumentierte er mit Blick auf die Erfolge der NPD, dass diese rechte Partei erstmals „einen organisatorischen Massenappell“ ausübe, „ohne das sektiererische Aroma“ von NS-Nachfolgeparteien wie der 1952 verbotenen Sozialistischen Reichspartei (SRP) zu besitzen (Adorno 2019: 21). Ebenfalls zeitgenössisch bezeichnete der Historiker Lutz Niethammer das Phänomen als „angepaßten Faschismus“ (Niethammer 1967: 8; dazu Müller 2019b).
Die „Neue Rechte“ hat also nicht nur von den Protestpraktiken der „Neuen Linken“ gelernt – das betrifft eher die Avantgarde rechtsintellektueller Bewegungen (Weiß 2017). Für ihre Wirkung in der Breite wichtiger ist, dass sie sich erfolgreich einen (vulgär-)demokratischen Anstrich gegeben hat, der in hohem Maße dazu beiträgt, die nationalistische Rechte zu einer wählbaren Alternative zu machen. „Das offen Antidemokratische“, so Adorno 1967, „fällt weg. Im Gegenteil: Man beruft sich auf die wahre Demokratie und schilt die anderen antidemokratisch.“ (Adorno 2019: 37) Allerdings geht mit dieser vermeintlichen Anpassung der radikalen Rechten an die Demokratie die Legitimation und damit Zunahme rechter und rassistischer Gewalt einher: ein paradoxer Prozess, der nach 1968 ebenso zu beobachten ist wie in den 1980er Jahren, nach 1990, um 2000 und heute.
Formierung: Mobilisierung von rechts um 1968
Die Formierungsphase eines radikalen Nationalismus innerhalb des bundesdeutschen demokratischen Systems liegt in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Die Nationaldemokraten (NPD) hatten sich als Sammlungsbewegung gegründet, die nationalkonservativen und rechtsradikalen Gruppen eine gemeinsame politische Heimat bieten, sich von neo-nazistischen Parteigründungen abgrenzen und so breitere Bevölkerungskreise erreichen wollte. „Deutschland den Deutschen“, dieser mit dem Zusatz „Ausländer raus!“ nach der Vereinigung so oft geschriene Slogan, hat seinen Ursprung in dieser Zeit. „Deutschland den Deutschen – Europa den Europäern“ war 1964 das Manifest der Partei überschrieben. Damit protestierte die NPD gegen die vermeintliche „Fremdherrschaft“ der Besatzungsmächte, gegen Reeducation, den Zwang zu Wiedergutmachung und Entschädigung und für eine souveräne deutsche Nation.
Tatsächlich gelang der NPD eine bis dahin vergleichslose Breitenwirkung: Bei den Landtagswahlen dieser Jahre konnte sie hohe Stimmgewinne verzeichnen, 1968 erreichte sie in Baden-Württemberg mit 9,8 Prozent ihr bestes Ergebnis. Zwar scheiterte sie bei der Bundestagswahl 1969 mit 4,3 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, bis 2017 aber kam keine Partei rechts von der Union dem Einzug in den Bundestag näher. Dass das gelang, lag an einer komplexen Gemengelage von Faktoren. Erstens erlebte die Bundesrepublik 1966/67 eine erste, wenngleich noch recht harmlose ökonomische Flaute, die der Bevölkerung gleichwohl zu Bewusstsein brachte, dass stetes Wirtschaftswachstum kein Naturgesetz der Nachkriegszeit war. Seitdem und bis heute ist die Instrumentalisierung wirtschaftlicher Abstiegsängste ein wesentliches Erfolgsrezept rechter Politik. Zweitens gingen CDU/CSU und SPD erstmals eine große Koalition auf Bundesebene ein, der vormalige baden-württembergische Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger wurde deren Kanzler (und von rechtskonservativen Wählern und Wählerinnen im „Ländle“ sicher auch dafür abgestraft). Die Große Koalition, aber auch die weitere Volksparteiwerdung der CDU ließ Raum für die politische Mobilisierung von rechts. Hinzu kam eine Wahlkampfstrategie, die dicht an den Menschen blieb und auch dort Präsenz zeigte, wohin die etablierten Parteien sich nicht (mehr) verirrten: in die ländlichen Räume, wo die NPD wirksam Wahlwerbung an Haustüren und in Kneipen machte (Botsch 2012: 49/59). Drittens riefen der politische Wandel, die gesellschaftliche Liberalisierung und die Entwicklung einer linken Jugend- und Protestkultur mehr oder weniger radikale Gegenreaktionen hervor.
Die ersten breiteren Mobilisierungserfolge gründen also in einer Mischung von ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen seit Mitte/Ende der 60er Jahre. Dabei passte sich die Rechte auf ambivalente Weise an die bundesdeutsche Nachkriegsdemokratie an, indem sie sich zunehmend als deren immanente Opposition und bessere Alternative gerierte. In diesem Prozess versuchte die NPD zudem, Traditionslinien zum Nationalsozialismus strategisch zu kappen und neo-nationalsozialistische Gruppen in ihren Reihen gleichzeitig auszuschließen und zu integrieren – eine widersprüchliche Strategie, die noch heute bei der AfD zu beobachten ist. Es sei, so Gideon Botsch, eine „Grundsatzentscheidung der NPD“ gewesen, „zugleich als legale Partei und als Fundamentalopposition aufzutreten“ (Botsch 2017: 69). Für den Erfolg in der ganzen Breite der Bevölkerung war dieser strategisch-taktische, aber auch ideologische Anpassungsprozess eine wesentliche Voraussetzung, von dem der radikale Nationalismus heute profitiert. Noch viel ausgeprägter als die NPD stilisiert sich die AfD ja gerade als Kraft des Widerstands gegen die vermeintliche „Diktatur“ der „Altparteien“ und als erste Vertreterin einer „wahren Demokratie“.
Zwar formierte sich in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre eine rechtsradikale Opposition im demokratischen System; als dauerhaft erwies sich deren Mobilisierungsfähigkeit aber nicht. Nach 1969 versank die NPD in der Bedeutungslosigkeit, während die CDU vor allem auf Länderebene massive Wahlerfolge verzeichnete – ein Absorptionsprozess durch den demokratischen Konservatismus, der heute nicht mehr ohne Weiteres gelingt (Livi et al. 2010). Der rechtsextreme Flügel zog sich in den Untergrund zurück, es entstanden Terrorstrukturen wie die 1973 in Nürnberg gegründete „Wehrsportgruppe Hoffmann“. Anfang der 80er Jahre folgte eine bis dahin vergleichslose Welle rechter Gewalt in der Bundesrepublik.
Schmiermittel: Rassismus in Bundesrepublik und DDR der 1980er Jahre
Woran liegt es, dass die Mobilisierung von rechts erst Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre, dann aber stetig, wieder Erfolge verzeichnete? Es spricht einiges dafür, dass nun die zeitgenössisch so bezeichnete „Fremdenfeindlichkeit“ zum effektiven Hauptschmiermittel rechter Mobilisierung avancierte. Einschneidende wirtschaftliche Rezessionen – die erste und zweite Ölpreiskrise 1973 und 1979 –, steigende Arbeitslosigkeit und eine allgemeine Zukunftsangst korrespondierten mit einer zunehmenden Migration in die Bundesrepublik; „Ausländer“ wurden als Konkurrenten um begrenzte gesellschaftliche Ressourcen empfunden. Die Spannbreite des Rassismus reichte von alltäglicher Diskriminierung und Übergriffen in den öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu Anschlägen rechtsextremer Terrorgruppen. Seit dieser Zeit machten sich rechte Bewegungen und Parteien rassistische Ressentiments zunutze, eine Kontinuitätslinie, die – deutlich gezogen und von der aus dieser Sicht gar nicht mehr so friedlichen Revolution höchstens kurzzeitig unterbrochen – bis in die Gegenwart führt.
Seit den 80er Jahren waren Migranten und Migrantinnen in der Bundesrepublik präsenter als je zuvor: Einerseits zogen viele „Gastarbeiter“ nach dem konjunkturbedingten, wenngleich schon vorher verhandelten Anwerbestopp 1973 ihre Familien nach. Andererseits stiegen seit Ende der 70er die Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen, man denke nur an die Boatpeople aus Vietnam oder an die Flüchtlinge, die nach dem Militärputsch 1980 aus der Türkei oder nach der Verhängung des Kriegsrechts 1981 aus Polen flüchteten. Bereits zu Beginn der Gastarbeiterwerbung Mitte der 1950er Jahre hatte es rassistische Ressentiments gegeben. Solange die „Gastarbeiter“ jedoch nur auf Zeit im Land zu bleiben schienen und das Wirtschaftswachstum beförderten, war man ihnen mit einer Art wohlwollender Ignoranz begegnet. Ablehnung war ihnen vor allem dann entgegengeschlagen, wenn sie die Schwelle zum deutschen Alltag überschreiten wollten, wovon Schilder zeugen, die Gastwirte an ihre Türen hängten: „Ausländer unerwünscht“ oder „Keine Türken“ stand darauf (Möhring 2013: 286, FN 7).
In den 1980er Jahren dagegen artikulierten sich rassistische Ressentiments offensiver und überall: Türkenwitze kursierten auf den Schulhöfen und an Stammtischen, ausländisch aussehende Menschen wurden auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln angegriffen oder Opfer rechtsterroristischer Attentate. Im August 1980 verübten Angehörige der „Deutschen Aktionsgruppen“ einen Anschlag auf ein Hamburger Flüchtlingsheim, bei dem zwei vietnamesische Flüchtlinge starben. Anfang 1981 erschossen Mitglieder der „Wehrsportgruppe Hoffmann“ den ehemaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Nürnberg, Shlomo Lewin, und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke, in der Silvesternacht desselben Jahres wurde der Türke Seydi Battal Koparan von rechten Rockern erschlagen. Diese Ereignisse im zeitlichen Umfeld des notorisch genannten Oktoberfestattentats vom Oktober 1980, denen man andere hinzufügen könnte, verweisen auf die ganze Breite des Phänomens. Es ist erstaunlich und erklärungsbedürftig, dass sie, anders als Gewaltereignisse nach 1990 wie Rostock-Lichtenhagen oder Mölln, gesellschaftlich bis heute kaum erinnert werden.
Jenseits solcher – notwendig unvollständigen – chronikartigen Aufzählungen ist der westdeutsche Rassismus in den 80er Jahren zeithistorisch kaum untersucht. Das ist auch darum ein Manko, weil ohne diese Vorgeschichte der militant rassistische Nationalismus nach 1989/90 in West- und Ostdeutschland nicht zu verstehen ist. Die sich zuspitzende Anti-Asyl-Stimmung, von den Nachrichtenmedien des Landes mit starken Bildern und Schlagzeilen geschürt, wurde gleichermaßen politisch induziert wie instrumentalisiert. Erstmals 1986 machte die CSU auf Landesebene Wahlkampf mit dem Thema, und 1989 zogen die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Auf Bundesebene dominierten Rückkehrappelle und -prämien, und die politischen Eliten hielten, gegen jede Evidenz, an einem Dogma fest, dem schon die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt gefolgt war: „Deutschland ist kein Einwanderungsland“. Daneben entwickelten sich rechte Bewegungen von unten wie die „Bürgerinitiativen Ausländerstopp“; solche Protestformen, nach 1990 in die neuen Länder exportiert, sind also mitnichten nur ein Spezifikum Ostdeutschlands. Gleichzeitig entstanden bürgerschaftliche Initiativen gegen rechts und eine Lobby für die Opfer rechter Gewalt, die sich zunehmend auch selbst organisierten. Eine Geschichte der Mobilisierung von rechts darf gerade dieses Kapitel nicht außer Acht lassen, auch weil es zur Vorgeschichte der „Willkommenskultur“ von 2015 gehört.
Solche Strukturen der Interessen- und Rechtsvertretung für Migranten und Migrantinnen konnten sich in der DDR – bis auf keimhafte Ansätze in den allerletzten Jahren – nicht ausprägen. Das mag auch an dem im Vergleich geringen quantitativen Ausmaß liegen: Die Zahl der Ausländer überstieg in der DDR nie ein Prozent (in der Bundesrepublik waren es 1989 bereits etwa sieben Prozent der Bevölkerung, rund fünf Millionen Menschen). Wegen der zugespitzten Wirtschaftskrise waren in den 80er Jahren knapp 100.000 „ausländische Werktätige“ vor allem aus Vietnam und Mosambik angeworben worden, die die mangelnde Modernisierung der Wirtschaft, aber auch die Ausreisebewegung gen Westen kompensieren sollten. Jenseits der Propaganda von der „sozialistischen Völkerfreundschaft“ wurden sie in der realsozialistischen Praxis oft nicht ausgebildet, sondern für einfache Hilfstätigkeiten eingesetzt. Anders als für die „Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik gab es für sie kaum Optionen des Bleibens, auch kein Recht auf Familiennachzug oder Einbürgerung, zudem war die Zeit zu kurz und die Politik zu rigide, als dass die Bevölkerung einen konstruktiven Umgang mit den „Fremden“ hätte einüben können (vgl. allgemein dazu Behrends et al. 2003). In der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und mentalen Endkrise der DDR kam es immer wieder zu Diskriminierungen und tätlichen Übergriffen, die von der SED-Regierung weitgehend tabuisiert, einem devianten »Rowdytum« zugeschrieben oder als Provokationen aus dem Westen wegerklärt wurden, aber dennoch wahrgenommen und punktuell auch problematisiert wurden (vgl. dazu den Aufsatz von Carsta Langner in diesem Band).
Reaktivierungen: „Vereinigungsrassismus“ in den 1990ern
Diese beiden Vorgeschichten wirkten zusammen und verstärkten einander, als nach der Vereinigung die bis dahin größten Wellen rassistischer Gewalt über das Land gingen: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ – das wurde jetzt während der pogromartigen Ausschreitungen gegen „Asylanten“ oder ehemalige „Vertragsarbeiter“ geschrien: in Hoyerswerda im September 1991, in Mannheim-Schönau im Mai 1992 oder in Rostock-Lichtenhagen im August desselben Jahres. Diesen Gewaltereignissen wird man nicht gerecht, wenn man ihnen mit einseitigen Erklärungen beizukommen sucht: etwa einer genuin ostdeutschen „Fremdenfeindlichkeit“ oder der Transformationskrise. Verstehen lässt sich diese komplexe Gewaltgeschichte nur, wenn man sie auch in den Kontext ihrer deutsch-deutschen Genese vor 1989/90 verortet. Was sich hier äußerte, war ein „Vereinigungsrassismus“ im doppelten Sinne des Wortes: weil zusammenkam, was sich vor 1989 in beiden deutschen Staaten entwickelt hatte, und weil die krisenhafte Transformation diesen Prozess noch beschleunigte.
Die hitzige Asyl-Debatte der 80er Jahre wurde jetzt in einen aufnahmebereiten Osten exportiert, zusammen mit rechten Akteuren aus dem Westen und einer radikalisierenden Berichterstattung, die Migranten und Migrantinnen in der ökonomischen Krise als Konkurrenten und Sündenböcke stigmatisierte, als „Scheinasylanten“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“. Der rassistische Nationalismus diente als eine Art Kompensation für den Statusverlust, als regressive Homogenitätsfantasie in einer Phase umfassenden Orientierungsverlusts und stetiger Delegitimierungserfahrungen (vgl. Beitrag von Berendsen & Koss in diesem Band). Das politische Vakuum ermöglichte Formen der Selbstjustiz, die vielleicht auch als vermeintliches Recht in einer „wahren Demokratie“ missverstanden wurden. Stellvertretend dafür stehen die Bilder applaudierender Nachbarn in Rostock-Lichtenhagen; sie machten den „nachbarschaftlichen Rassismus“ und Versuche konsensfähig, das Problem auf dem Weg der Selbstjustiz zu lösen (der Begriff bei Jentsch 2016: 64).
Schluss: Wo stehen wir seit 2015?
Diese Phase nationalistischer und rassistischer (Selbst-)Mobilisierung Anfang der 1990er Jahre spielte in den Diskussionen einer breiteren Öffentlichkeit seit 2015 kaum eine Rolle, obwohl sich aus der Beschäftigung mit dieser Vorgeschichte viel lernen ließe.2 Sie macht deutlich, wie einfach es war, den latenten Rassismus zu aktivieren, auch weil dieser Mobilisierung von unten politisch zu wenig entgegengesetzt wurde und weil Gegenkräfte sich noch nicht formiert hatten oder zu schwach waren. Die politischen Eliten hielten an der Fiktion fest, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei, 1993 wurde das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt, und die Medien, auch die etablierten, schürten den Ausländerhass mit einer unverantwortlichen Bildpolitik und unreflektierten Sprache. Dagegen folgte die Mobilisierung von rechts um 2000 auf einen dezidierten Öffnungsprozess, nämlich die Reformen des Staatsbürgerschaftsrechts durch die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Diese späte Anerkenntnis der Tatsache, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland war, rief Abwehrprozesse auf mehreren Ebenen hervor: Man denke nur an die Kampagnen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft in der Bundes-CDU, aber vor allem in Hessen unter Roland Koch („Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben?“), an die Leitkulturdebatte eines Friedrich Merz, an den Einzug der NPD in den sächsischen Landtag 2004, aber auch an die wieder steigende Zahl rassistischer An- und Übergriffe.
Dennoch: Rückgängig zu machen war der (wenn auch immer wieder stockende) politische Prozess einer Umwandlung Deutschlands in ein Einwanderungsland nicht mehr. Der direkte Vergleich der Konjunkturen rechter Mobilisierung im vereinten Deutschland zeigt eben auch, dass sich Vieles zum Besseren verändert hat, nicht nur im Westen, sondern gerade auch im Osten Deutschlands: Politische Institutionen wie bürgerschaftliche Initiativen gegen rechts haben sich etabliert, kooperieren miteinander und bieten einem übersteigerten rassistischen Nationalismus die Stirn. Sollten diese positiven Entwicklungen nicht viel deutlicher herausgestellt werden – als wirksames Mittel nicht nur gegen die radikale Rechte, sondern auch gegen eine alarmistische und polarisierte Debatte?
Zugleich aber bleiben die seinerzeit ausgebildeten Formen der Selbstmobilisierung von unten wirksam. Mehr noch haben sie mit Bewegungen wie Pegida oder Parteien wie der AfD festere Strukturen der Repräsentation ausgebildet, die von einem jahrzehntelangen strategischen Umbau- und Anpassungsprozess profitieren, infolge dessen sich die radikale Rechte als demokratische Alternative, ja als „wahre Demokratie“ geriert, als Kraft des Widerstands gegen die nur scheindemokratische Diktatur von „Denen-da-oben“. Ihren Rassismus verkaufen sie als feinere, differenzierte Form von Kultur-Kritik und Ethnopluralismus. In dieser modernisierten und vermeintlich moderateren Form erscheint die Politik eines vulgärdemokratischen Nationalismus vielen wählbar. Allerdings macht nicht zuletzt der Blick in die Geschichte deutlich, dass mit der Repräsentation rechter Politik und den Wahlerfolgen rechter Parteien regelmäßig die Zunahme rassistischer Gewalt einhergeht oder ihr auf dem Fuße folgt. Denn rechtsradikalen Gewalttätern dient die politische und gesellschaftliche Repräsentation ihrer Meinung letztlich als Legitimation.
1
Die erste Tagung des Arbeitskreises zum Thema „Kontinuitäten rechter Gewalt“ fand im Februar 2020 in Potsdam statt: zzf-potsdam.de/de/veranstaltungen/kontinuitaten-rechter-gewalt-ideologien-praktiken-wirkungen.
2
Jüngst werden Erinnerungen an die fast alltäglichen Übergriffe unter dem Hashtag „Baseballschlägerjahre“ ausgetauscht: twitter.com/hashtag/baseballschlaegerjahre.
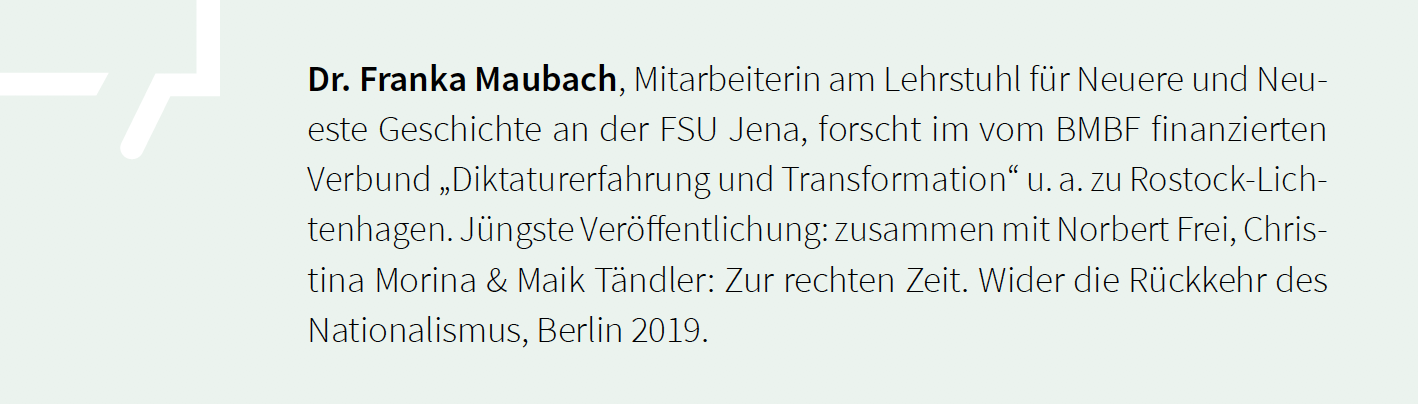
Literatur
Adorno, Theodor W. (2019): Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Ein Vortrag, mit einem Nachwort von Volker Weiß. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Behrends, Jan C./Lindenberger, Thomas/Poutrus, Patrice G. (2003) [Hrsg.]: Fremde und Fremd-Sein in der DDR. Zu historischen Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland. Berlin.
Botsch, Gideon (2012): Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
Botsch, Gideon (2017): Wahre Demokratie und Volksgemeinschaft. Ideologie und Programmatik der NPD und ihres rechtsextremen Umfelds. Springer VS: Wiesbaden.
Doering-Manteuffel, Anselm/Raphael, Lutz/Schlemmer, Thomas (2016) [Hrsg.]: Vorgeschichte der Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom. Vandenhoek & Ruprecht: Göttingen.
Frei, Norbert/Maubach, Franka/Morina, Christina/Tändler, Maik (2019): Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus. Ullstein: Berlin.
Greiffenhagen, Martin (1981): 5 Millionen Deutsche: „Wir sollten wieder einen Führer haben ...“ Die SINUS-Studie über rechtsextremistische Einstellungen bei den Deutschen. Rowohlt: Reinbek bei Hamburg.
Jentsch, Ulli (2016): Im „Rassenkrieg“. Von der Nationalsozialistischen Bewegung zum NS-Untergrund, in: Kleffner, Heike/Spangenberg, Anna [Hrsg.]: Generation Hoyerswerda. be.bra Verlag: Berlin, S. 62–71.
Kleffner, Heike/Spangenberg, Anna [Hrsg.] (2016): Generation Hoyerswerda. Das Netzwerk militanter Neonazis in Brandenburg. be.bra Verlag: Berlin.
Livi, Massimiliano/Schmidt, Daniel/Sturm, Michaela (2010) [Hrsg.]: Die 1970er Jahre als schwarzes Jahrzehnt. Politisierung und Mobilisierung zwischen christlicher Demokratie und extremer Rechter. Campus: Frankfurt a.M.
Metzler, Gabriele [Hrsg.] (2013): Das Andere denken. Repräsentationen von Migration in Westeuropa und den USA im 20. Jahrhundert. Campus: Frankfurt a. M.
Möhring, Maren (2013): Anders essen in der Bundesrepublik: Begegnungen im ausländischen Spezialitätenrestaurant. In: Metzler, Gabriele [Hrsg.]: Das Andere denken. Campus: Frankfurt a.M., S. 283–299.
Müller, Yves (2019):
„Normalfall“ Neonazi – oder: Gibt es eine zeithistorische Rechtsextremismus-Forschung? Online: zeitgeschichte-online.de/themen/normalfall-neonazi-oder-gibt-es-eine-zeithistorische-rechtsextremismus-forschung [18.03.2020].
Müller, Yves (2019b):
„Faschistische Grundstruktur“. Lutz Niethammers Analyse der extremen Rechten (1969). Online: zeithistorische-forschungen.de/1-2019/5696 [18.03.2020].
Quent, Matthias (2019): Deutschland rechts außen. Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Piper: München.
Niethammer, Lutz (1969): Angepaßter Faschismus. Politische Praxis der NPD. S. Fischer: Frankfurt a. M.
Weiß, Volker (2017): Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Klett-Cotta: Stuttgart.
Wirsching, Andreas/Kohler, Berthold/Wilhelm, Ulrich (2018) [Hrsg.]: Weimarer Verhältnisse? Historische Lektionen für unsere Demokratie. bpb: Berlin.
Zick, Andreas/Küpper, Barbara/Berghan, Wilhelm (2019): Verlorene Mitte – feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018 /2019. Dietz: Berlin.