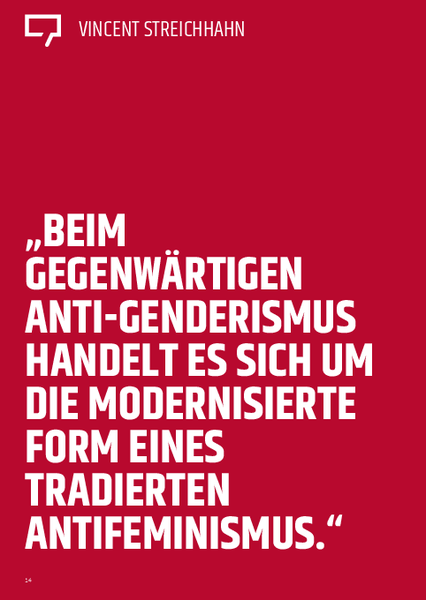Bevor der Antifeminismus genauer in den Blick genommen wird, lohnt ein rasanter Ritt durch die Geschichte, um nachzuvollziehen, wie in der Vergangenheit über Geschlecht(er) nachgedacht wurde. Die Vorstellung eines „naturgegebenen“ und biologisch begründeten Unterschiedes von Frauen und Männern ist tatsächlich eine recht junge Erfindung. Bis in das 18. Jahrhundert dominierte die Vorstellung, es gebe nur ein Geschlecht, welches bei Männern und Frauen unterschiedlich stark ausgeprägt sei (Laqueur 1992). Gleichberechtigt waren die Geschlechter deshalb keineswegs. Die Frau war, zugespitzt ausgedrückt, nur ein halber Mann. Die Vorstellungswelt wandelte sich im Zuge der Aufklärung und dem Siegeszug der Naturwissenschaften. Fortan wurden die beiden Geschlechter zu einem Gegensatzpaar mit bestimmten, vermeintlich biologisch determinierten Eigenschaften erklärt. Während die ungleiche soziale Stellung der Geschlechter vorher in erster Linie durch eine vermeintlich göttliche Ordnung legitimiert wurde, etablierten sich biologische Argumentationsmuster. Die Historikerin Karin Hausen (1976: 363ff.) hat diesen Wandel als „Polarisierung der ‚Geschlechtscharaktere‘“ beschrieben. Kurz gesagt: Frauen seien aufgrund ihrer „Natur“ sanfter, für den Haushalt und die Kindererziehung zuständig, wogegen Männer stark, vernunftbegabt seien und die Ernährer der Familie darstellen. Diese Vorstellung prägt weiterhin unsere Gegenwart (Bauer et al 2018). Frauen sind mehrheitlich für die Hausarbeit zuständig, häufiger teilzeitbeschäftigt und stärker von Armut und sexualisierter Gewalt betroffen. Die gesellschaftliche Situation hinsichtlich der Geschlechtergleichstellung sowie sexueller und reproduktiver Rechte ist indes äußerst widersprüchlich: Die Gesetzgeber_innen setzten zum Oktober 2017 im Bundestag die „Ehe für alle“ durch, gleichzeitig wurde die Ärztin Kristina Hänel nur einen Monat später auf der Grundlage von §219a vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf ihrer Internetseite auf das medizinische Angebot eines Schwangerschaftsabbruches verwies. Antifeminist_innen machen in den vergangenen Jahren wieder verstärkt mobil auf der Straße (AK Fe.In 2019) und stehen damit in einer Tradition, die die Geschichte seit Beginn der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert begleitet. Beim Antifeminismus handelt es sich um ein langlebiges Phänomen, das gegenwärtig bis weit in die „Mitte“ der Gesellschaft reicht und in diesem Artikel in historisch-vergleichender Absicht dargestellt wird.
Dafür wird zunächst der Begriff des Antifeminismus beschrieben. Bevor sich der Beitrag der Gegenwart zuwendet, soll ein Blick in die Vergangenheit der bürgerlichen 1848er Revolution und des deutschen Kaiserreichs (1871–1918) geworfen werden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen. Abschließend wird die aktuelle feministische Gegenwehr thematisiert und es werden gegenwärtige Herausforderungen an die Zivilgesellschaft skizziert. Die Gleichstellung der Geschlechter, das hat die Demokratiegeschichte gezeigt, muss durch zivilgesellschaftlichen Druck vorangetrieben, erkämpft und immer wieder verteidigt werden.
Antifeminismus als Abwehrbewegung
Der Antifeminismus ist so alt wie die Frauenbewegung selbst, die im Übergang zur Moderne die politische Bühne der Geschichte betritt. In der wissenschaftlichen Forschung wird der Antifeminismus als Widerstand gegen die Emanzipationsbestrebungen von Frauen verstanden und unterscheidet sich damit von anderen verwandten Termini: Misogynie, Frauenfeindlichkeit, Sexismus (Schmincke 2018). Die Sozialwissenschaftlerin Herrad Schenk (1980: 163) betont die analytische Notwendigkeit einer Begriffsunterscheidung:
Es erscheint sinnvoll, zwischen ‚Frauenfeindlichkeit‘ im allgemeinen und ‚Antifeminismus‘ im engeren Sinn zu trennen, obwohl beide Phänomene gelegentlich ineinander übergehen. Frauenfeindlichkeit hat es, lange vor dem Auftreten einer Frauenbewegung, immer wieder gegeben; sie bildet einen festen Bestandteil abendländischer Kultur. Unter ‚Antifeminismus‘ soll hier nur Frauenfeindlichkeit verstanden werden, die direkt als Reaktion auf die Frauenbewegung, als Widerstand gegen deren tatsächliche oder vermeintliche Ziele anzusehen ist.
Damit wäre eine Arbeitsdefinition gefunden, die jedoch noch durch zwei Elemente ergänzt werden muss: 1) Der Antifeminismus tritt als mehr oder weniger stark institutionalisierte Bewegung auf, die Akteur_innen verschiedener politischer Richtungen als Teil eines gemeinsamen regressiven Gesellschaftsprojektes zumindest diskursiv verbindet. 2) Jede geschichtliche Periode hat ihren spezifischen Antifeminismus. Im Folgenden wird zu zeigen sein, dass der ab den 1990er Jahren sich durchsetzende Anti-Genderismus nichts qualitativ Neues darstellt, sondern dass lediglich ein Formwandel stattgefunden hat. Der Anti-Genderismus ist eine modernisierte Variante des Antifeminismus und richtet sich nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen andere sexuelle und geschlechtliche Identitäten jenseits der binären Geschlechterordnung.
Das deutsche Kaiserreich – zwischen Antifeminismus und Emanzipation
Mit der bürgerlichen Revolution von 1848 erhoben Frauen wie Louise Otto in Deutschland ihre Stimmen, um für die politischen Rechte des weiblichen Geschlechts einzutreten. In der von ihr herausgegebenen Frauen-Zeitung, die am 21. April 1849 mit dem Untertitel „Dem Reich der Frauen werb’ ich Bürgerinnen“ das erste Mal erschien, ruft Otto ihre Geschlechtsgenossinnen zum Kampf für eine gleichberechtigte Gesellschaft auf:
Wohl auf denn meine Schwestern, vereinigt Euch mit mir, damit wir nicht zurückbleiben, wo Alle und Alles um uns neben uns vorwärts drängt und kämpft. [...] Wir wollen unseren Theil fordern: das Recht, das Rein-Menschliche in uns in freier Entwicklung aller unserer Kräfte auszubilden, und das Recht der Mündigkeit und Selbständigkeit im Staat. (Louise Otto 1849: 1)
Das war ein Skandal. Frauen hatten damals das Heim zu hüten und die öffentliche Bühne keinesfalls zu betreten. Zwar scheiterte die bürgerliche 1848er Revolution in Deutschland, die Frauen-Zeitung wurde nach wenigen Jahren eingestellt und das 1850 erlassene preußische Vereinsgesetz verbot es Frauen noch bis 1908, sich politisch zu organisieren. Doch der demokratische Gedanke ließ die Frauenrechtlerinnen nicht mehr los. Als Beginn der deutschen Frauenbewegung gilt gemeinhin der von Auguste Schmidt und Louise Otto 1865 in Leipzig gegründete Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF), der jedoch jeden Anschein politischer Aktivitäten und Forderungen vermeiden musste, um nicht von den Behörden verboten zu werden. Der Handlungsspielraum des ADF wurde dadurch stark eingeschränkt. Trotz teils tiefer inhaltlicher Differenzen stellten sowohl die bürgerliche als auch die proletarische Frauenbewegung vermeintliche Selbstverständlichkeiten radikal infrage.
Die antifeministische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die gesellschaftliche Elite des 1871 geschaffenen deutschen Kaiserreichs überbot sich darin, kreative Begründungen für die vermeintliche Minderwertigkeit der Frau zu finden. Der angesehene preußische Historiker Heinrich von Treitschke (1834–1896), überzeugter Antisemit und Antifeminist, brachte das damalige Zeitverständnis auf den Punkt: „Obrigkeit ist männlich; das ist ein Satz, der sich eigentlich von selbst versteht“ (zitiert nach Planert 1998: 36). Auch der deutsche Publizist und Antisemit Otto Glagau, der im April 1883 den zweiten Internationalen Antijüdischen Kongress in Chemnitz leitete, rief die aufbegehrenden Frauen 1870 zur Ordnung: „Genug, die ‚Emancipation‘ ist eine ebensolch lächerliche und unausführbare Theorie, wie alle anderen Theorien der Communisten und Socialisten“ (zitiert nach Planert 1998: 27).
Im selben Jahr öffnete die Universität in Zürich ihre Hörsäle für Frauen und sogleich begannen zwei Frauen aus Deutschland, Emilie Lehmus und Franziska Tiburtius, in der Schweiz Medizin zu studieren. Der Münchner Anatomieprofessor Theodor Bischoff vermerkte 1872 fassungslos: „[D]em weiblichen Geschlecht [fehlt] nach göttlicher und natürlicher Anordnung die Befähigung zur Pflege und Ausübung der Wissenschaften und vor allem der Naturwissenschaft und Medizin.“ Die mögliche Anwesenheit von Frauen auch in deutschen Gymnasien und Universitäten, war Bischoff sich sicher, „[...] gefährde das sittliche Wohl der männlichen Teilnehmer auf das allerschlimmste“ (zitiert nach Beuys 2014: 32).
Der Höhepunkt der antifeministischen Mobilisierung
Den Höhepunkt der antifeministischen Mobilisierung bildete der 1912 gegründete „Deutsche Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation“, der verschiedene soziale Gruppen nun auch organisatorisch zusammenbrachte: Darunter befanden sich neben Vertreter_innen des Großbürgertums und der Mittelschichten auch Großgrundbesitzer, Adlige, Landwirte, national-konservative und völkische Akteur_innen. Es muss erwähnt werden, dass im neu gegründeten Bund ein Viertel der Mitglieder weiblichen Geschlechts waren (Maurer 2018: 41). Das mag zunächst irritieren, aber Frauen kämpften klassenübergreifend gegen ihren gefürchteten Bedeutungsverlust als Hausfrau. Der historische Antifeminismus war somit, das wird häufig übersehen, nicht nur eine Reaktion auf die Emanzipationsbestrebungen von Frauen, sondern auch Resultat eines tiefer liegenden Transformationsprozesses der Geschlechterordnung.
Hedwig Dohm (1902) teilte das breite Spektrum der emanzipationsfeindlichen Akteur_innen bereits in ihrer berühmten Schrift „Die Antifeministen“ in vier Gruppen ein, die sich in ihrer Argumentationsweise voneinander unterscheiden: Die „Altgläubigen“ berufen sich auf eine angebliche Tradition, die es zu bewahren gelte. Die Geschlechterverhältnisse seien demnach für alle Zeit festgeschrieben. Den „Herrenrechtlern“ geht es hingegen ganz explizit um die Sicherung der eigenen Vormachtstellung. Die „praktischen Egoisten“ geben sich mitunter freundlich, aber profitieren gerne von den Annehmlichkeiten, die ihnen eine „sorgende“ Hausfrau bereitet. Die „Ritter der mater dolorosa“ verteidigen mit vollem Herzblut die Mutterrolle der Frau als ihre „natürliche“ Bestimmung.
Es bleibt festzuhalten: Das antifeministische Ressentiment gehörte zum guten Ton der Elite des deutschen Kaiserreichs. Doch alle antifeministischen Widerstände konnten nicht verhindern, dass das Frauenwahlrecht durch die deutsche Novemberrevolution 1918 Realität wurde. Bei der Wahl zur Nationalversammlung konnten Frauen im Januar 1919 in Deutschland das erste Mal ihr Kreuz in der Wahlkabine machen. Über 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen schritten zur Wahlurne (Hindenburg 2018). Bereits im Kaiserreich haben Frauen neue Rollen erfunden, wie Lehmus und Tiburtius Arztpraxen eröffnet, Zeitungen gegründet und in Parteien gestritten. Der Weg zur zivilrechtlichen Gleichstellung der Geschlechter war jedoch noch ein weiter.
Bruch oder Kontinuität?
Es bedarf zumindest einiger Anmerkungen zur Entwicklung zwischen dem Kaiserreich und der zweiten Frauenbewegung, um Brüche und Kontinuitäten anzudeuten. Das Geschlechterverhältnis bewegte sich in der Weimarer Republik im Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne und zeichnete sich durch eine politische Ausdifferenzierung aus. Trotz einer grundlegenden Liberalisierung und damit einhergehenden neuen Tätigkeitsfeldern, Rollenverständnissen und politischen Positionierungen der Frau darf nicht verkannt werden, dass die Weimarer Republik auch von Kontinuitäten geprägt war. „In der Ehe blieb den Frauen die vollständige rechtliche Gleichheit versagt, das Abtreibungsrecht wurde nur ansatzweise liberalisiert, die Prostitution allerdings dereguliert und entkriminalisiert. In der Rechtsordnung der Weimarer Republik blieb die mindere Stellung der Frau somit in vieler Hinsicht festgeschrieben.“ (Metzler/Schumann 2016: 13f.)
In der Ideologie des Nationalsozialismus war die Frau klar auf die Rolle der Mutter als Erhalterin der „Volksgemeinschaft“ festgeschrieben, auch wenn die neuere Forschung inzwischen gezeigt hat, dass die Mehrheit der Frauen weder komplett in der Mutterrolle aufging noch weniger arbeitete als vor 1933. Die Handlungsräume von Frauen waren auch im Nationalsozialismus komplexer. So lässt sich konstatieren, dass „Misogynie kein wesentlicher Bestandteil der NS-Weltanschauung [war], sondern vielmehr die Verwendung essentialistischer Geschlechterbilder“ (Frietsch/Herkommer 2009: 24). Frietsch und Herkommer plädieren daher dafür, „die universalisierende Rede von der Frauenfeindlichkeit des Nationalsozialismus aufzugeben und stattdessen von seinem Antifeminismus zu sprechen“ (ebd.). In engem Zusammenhang zu diesem Antifeminismus stand der nationalsozialistische Antisemitismus, wie Planert (1998: 12) bereits für das Kaiserreich dargelegt hat.
Die 1950er und 60er Jahre waren in der Bonner Republik geprägt durch eine weitgehend ausbleibende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Fortleben reaktionärer Rollenmuster. Das „Allein-Ernährer-Modell“ mit der Frau als Hausfrau war das hegemoniale Ideal, welches von der Kulturindustrie sowie einer antifeministischen Familien- und Sozialpolitik nachhaltig tradiert wurde. In der DDR wurde hingegen aufgrund des Selbstverständnisses als sozialistischer Staat mit festgeschriebenen Gleichstellungsbestrebungen ein anderer Weg eingeschlagen. Frauen mussten berufstätig sein. Die staatliche Kinderbetreuung war dadurch weit ausgebaut (Gerhard 1994). Das heißt keineswegs, dass es in der DDR keine patriarchalen Strukturen in der Politik und im Privaten gegeben hätte. Frauen wurden trotz der staatlichen Gleichstellungspolitik schlechter bezahlt, waren kaum in Führungspositionen vertreten und litten unter der Doppelbelastung von Beruf und Hausarbeit.
Vom Antifeminismus zum Anti-Genderismus
Die zweite Frauenbewegung hat zu einer nachhaltigen Liberalisierung der Geschlechterverhältnisse beigetragen: Frauen dürfen seit 1977 einer Erwerbsarbeit nachgehen, ohne diese mit ihren vermeintlichen „Pflichten in Ehe und Familie“ in Einklang bringen zu müssen, 1994 wurde ein Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlassen und die Vergewaltigung in der Ehe ist seit 1997 ein Straftatbestand. Kurzum: Es kam infolge der zweiten Frauenbewegung zu einer weitgehenden zivilrechtlichen Gleichstellung der Geschlechter. Die antifeministische Reaktion kam prompt. Rebekka Blum (2019) zeichnet die im Zuge der oben genannten Gesetzgebungen ab Mitte der 1990er Jahre einsetzende mediale Debatte in ihrer jüngeren Studie nach. Im Kampf gegen die „Political Correctness“ zogen Journalist_innen bürgerlicher, konservativer und rechter Zeitungen gegen emanzipatorische Politiken ins Feld. Den Akteur_innen ist es laut Karsta Frank gelungen, antifeministische Aussagen wieder salonfähig zu machen (1996: 202).
In dieser Zeit zeichnet sich eine zentrale Verschiebung ab, die den Antifeminismus transformieren wird. Während die zweite Frauenbewegung noch überwiegend mit einer bipolaren Geschlechtervorstellung (Mann/Frau) operierte, wird diese Vorstellung durch die in den 1990er Jahren aufkommenden Genderstudies – inspiriert durch Judith Butler (1990) – dekonstruiert. Die Soziologin Nina Degele betont das gesellschaftliche Veränderungspotenzial dieser wissenschaftlichen Disziplin, die sie als „Verunsicherungswissenschaft“ versteht, da diese die Natürlichkeit der Geschlechterverhältnisse nachhaltig hinterfragt (2003: 9). An diese Entwicklung hat sich auch der Antifeminismus angepasst. Die sogenannte Gender-Ideologie wurde erstmals zur Jahrtausendwende im Umfeld des Vatikans verunglimpft, der die Delegitimierung der traditionellen und gottgewollten Geschlechterordnung befürchtete (von Redecker 2016).
Wie weit der Antifeminismus in das bürgerliche Milieu hineinreicht und inzwischen wieder offen vertreten wird, hat das Buch „Das Eva-Prinzip“ der einstigen Tagesschausprecherin Eva Herman (2006) gezeigt. Darin plädiert Herman für eine Rückkehr zu traditionellen Geschlechterbildern und löste in Deutschland eine mediale Debatte aus, die den Feldzug gegen Emanzipationsbestrebungen, verkörpert durch die Genderstudies und Gender-Mainstreaming1, verschärfte. Der Antifeminismus erweist sich dabei ähnlich wie im deutschen Kaiserreich als verbindendes Element, das christliche, aristokratische, nationalkonservative, rechtspopulistische bis hin zu rechtsextremen Akteur_innen zusammenbringt. Trotz aller Differenzen eint diese Akteur_innen die „Ideologie einer natürlichen Ordnung von sozialer Ungleichheit“, ob zwischen den Klassen, den Geschlechtern oder zwischen Einheimischen und Migrant_innen (Kemper 2016: 203).
Argumentationsmuster des Anti-Genderismus
Die Argumentationsmuster der Antifeminist_innen haben sich im Übergang zum Anti-Genderismus zweifelsfrei gewandelt: „Diese richten sich im Unterschied zum klassischen Antifeminismus nicht mehr primär gegen die Frauenbewegung und ihre Forderungen und Errungenschaften, sondern gegen die Geschlechterforschung und insbesondere das mit dem Gender-Begriff verbundene dekonstruktivistische Verständnis von Geschlecht“ (Maihofer/Schutzbach 2015: 202).2 Die beiden Autorinnen machen drei zentrale Argumentationsmuster aus: 1) Im Zusammenhang mit dem Gender-Begriff wird ein Bedrohungsszenario der sexuellen Vervielfältigung und Homo-Sexualisierung aufgebaut. Dabei wird angenommen, dass das Wissen über Sexualität und geschlechtliche Identitäten vor allem Kinder in ihrer Entwicklung gefährde und sie lesbisch, schwul, bisexuell oder transsexuell mache. 2) Es wird vor einer „genderistischen“ Gleichmacherei und Umerziehung durch Maßnahmen der sexuellen Bildung und Sexualpädagogik gewarnt. Diese, so der Glaube, zerstörten die bürgerliche Familie und dadurch die traditionelle Geschlechterordnung, die es zu verteidigen gelte. 3) Verantwortlich dafür seien die Genderstudies, denen aufgrund einer vermeintlichen Unwissenschaftlichkeit die Legitimität entzogen wird.
Unter Bezugnahme auf Birgit Sauer (2019), die insgesamt sechs Argumentationsmuster herausarbeitet, soll ein weiterer Punkt herangezogen werden: 4) Sauer identifiziert zusätzlich die „Konstruktion eines vermeintlich gleichberechtigten und emanzipierten Okzidents und eines frauenunterdrückenden, intoleranten Orients“ innerhalb der antifeministischen Rhetorik. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so die Antifeminist_innen, sei ein europäischer Wert, der in klarer Abgrenzung zur „Rückständigkeit“ von Migrant_innen stehe. Gewalt gegen Frauen sei ein „Einwanderungsphänomen“, wie etwa bei den Diskussionen zur Silvesternacht in Köln 2015/16 behauptet wurde. Damit wird eine effektive Verknüpfung von Anti-Gender- und Anti-Migrations-Mobilisierungen vorgenommen.
Anders als Maihofer und Schutzbach (2015) gehe ich nicht davon aus, dass der Anti-Genderismus lediglich eng mit dem Antifeminismus verbunden ist. Ich spreche hingegen von einem Formwandel des Antifeminismus, dessen modernisierte Variante der Anti-Genderismus darstellt. Aufgrund der Ausdifferenzierung feministischer Theorien und analog zur Modernisierung der „alten Rechten“ war es notwendig, neue Argumentationsmuster und Topoi zu entwickeln, um gesellschaftlich anschlussfähig zu werden und schlussendlich dasselbe wie in der Vergangenheit zu bekämpfen: die Errungenschaften der Frauen- und Queerbewegung.3
Anti-Genderismus als rechte Mobilisierungsstrategie
Die Anti-Gender-Mobilisierungen richten sich nicht allein gegen die Erfolge der Frauen- und Queerbewegung. In der Forschung wird außerdem auf die neoliberalen Veränderungen der letzten Jahrzehnte verwiesen, die zu einer Prekarisierung von Arbeit und einer größeren sozialen Ungleichheit geführt haben. Nicht nur in Deutschland kam es dabei zu einer umfassenden Transformation des Geschlechterverhältnisses, wie in anderer Form bereits im Übergang zur Moderne (Fraser 2016). Das Modell des männlichen Alleinverdieners, inklusive geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und heterosexueller Kleinfamilie, wurde vom Zwei-Ernährermodell und pluralistischen Familien-Arrangements infrage gestellt. Darauf reagieren antifeministische Akteur_innen. „Gender“ dient dabei, so Sauer (2019: 339), als „leerer Signifikant“ im rechtspopulistischen Diskurs: „Ganz unterschiedliche Themen der antagonistischen rechten Kommunikation können mit bzw. gegen ‚Gender‘ aufgerufen und in eine Strategie gegen ‚die da oben‘ sowie gegen die vermeintlich ‚Anderen‘ eingebaut werden. So bildet der Anti-Gender-Diskurs die Grundlage einer ‚männlichen Identitätspolitik‘.“ Somit sind die Angriffe auf den Feminismus und Gleichstellungspolitiken als Teil einer umfassenderen Strategie zu verstehen, die einen autoritären Umbau der Gesellschaft anstrebt.
Feministischer Widerstand
Die Angriffe auf die Errungenschaften der Frauen- und Queerbewegung haben ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Sie untergraben als Bestandteil eines regressiven Gesellschaftsprojekts den egalitären Anspruch einer modernen Demokratie. Gleichzeitig ist der Antifeminismus als Abwehrbewegung ein modernes Krisensymptom. Zeitweise latent bleibend, bricht er erneut aus und stellt langfristig erkämpfte Errungenschaften zur Disposition. Wie ist den antifeministischen Angriffen von heute entgegenzutreten? Die Antwort damals wie heute: Feministischer Widerstand!
Seit einigen Jahren formiert sich rund um den Globus eine neue Frauenbewegung, die für reproduktive Rechte, gleiche Bezahlung, echte Geschlechtergerechtigkeit und gegen sexualisierte Gewalt streitet. Auch die Arbeitskämpfe im Bildungs- und Gesundheitsbereich der letzten Jahre sind überwiegend weiblich geprägt (Artus 2019). Bei antifaschistischen Kämpfen wird die politische Bedeutung des Antifeminismus zunehmend herausgestellt. Ein neues feministisches Bewusstsein entsteht. Doch trotz all dieser erfreulichen Entwicklungen bedarf es großer Achtsamkeit. Vor allem die Instrumentalisierung des Feminismus für rassistische Ideen stellt eine Konfliktlinie dar, an der sich die feministische Bewegung nicht spalten lassen darf. Auch der Protest muss breiter werden: Die gesamte Zivilgesellschaft ist gefordert, den aktuellen Angriff gegen die Demokratie abzuwehren und das demokratische Versprechen der Moderne endlich einzulösen.
1 Die Europäische Union hat sich Ende der 1990er Jahre zum Gender-Mainstreaming verpflichtet. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter. Gleichstellungsaspekte sollen in allen politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen von vornherein beachtet werden, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen.
2 Die Ablehnung bzw. Kritik an einem dekonstruktivistischen Geschlechterverständnis und den gegenwärtigen Genderstudies ist nicht zwangsläufig antifeministisch motiviert. Auch von feministischen Strömungen, wie dem Radikalfeminismus oder materialistischen Feminismen, gibt es Kritik an diesen Ansätzen (Linkerhand 2018). Das Konzept „Gender“ wird ebenfalls in der Geschlechterforschung kritisch diskutiert (Casale/Rendtorff 2008). Diese Kritiken unterscheiden sich aber grundlegend von antifeministischen Argumentationen, da sie sich nicht gegen Emanzipationsbestrebungen richten, sondern aufgrund von abweichenden theoretischen Annahmen zu anderen Perspektiven und Schlussfolgerungen kommen.
3 Die Queerbewegung setzt sich kritisch mit Konstruktionsprozessen von Geschlecht und Sexualität sowie dessen sozialen Folgen auseinander. Sie hat ihren Ursprung in der Schwulen- und Lesbenbewegung des 20. Jahrhunderts und übt Kritik an der Essentialisierung und Vereinheitlichung von Identität. Ziel ist nicht nur die Dekonstruktion der binären Geschlechterordnung, sondern eine Pluralisierung von Sexualität und Lebensformen, der die Politik und Gesellschaft Rechnung tragen soll (Plötz 2014).
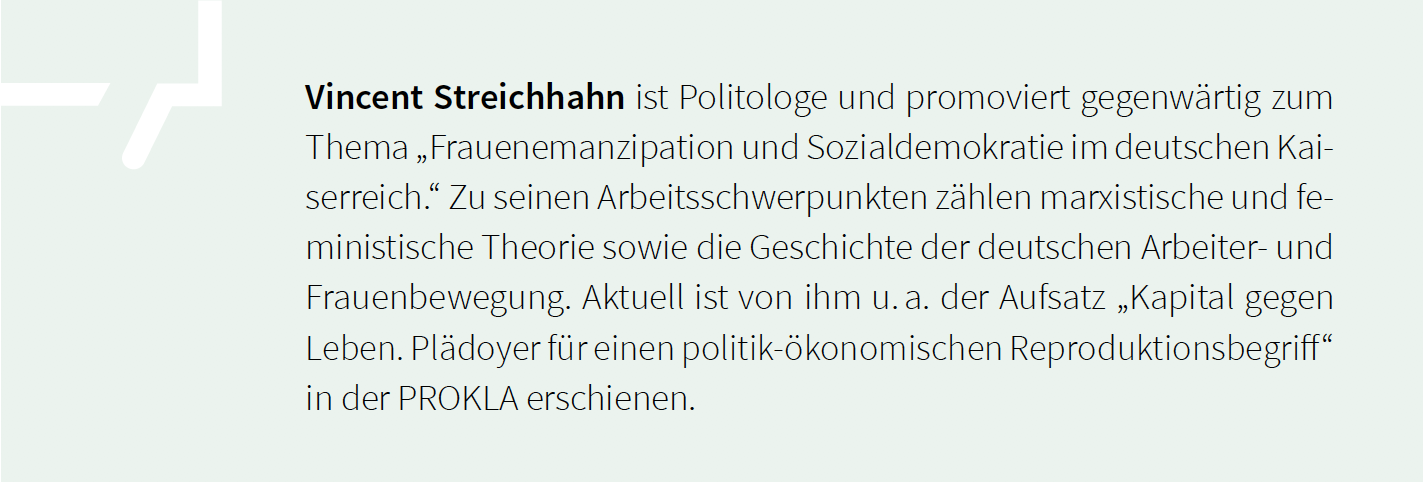
Literatur
AK Fe.In (2019): Frauen*rechte und Frauen*hass: Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt. Verbrecher Verlag: Berlin.
Artus, Ingrid (2019):
Frauen*streik! Zur Feminisierung von Arbeitskämpfen. RLS-Analysen 54: Berlin. Online: www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Analysen/Analysen54_FrauenStreik.pdf [21.02.2020].
Bauer, Gero/Ammicht Quinn, Regina/Hotz-Davies, Ingrid [Hrsg.] (2018): Die Naturalisierung des Geschlechts: Zur Beharrlichkeit der Zweigeschlechtlichkeit. Transcript: Bielefeld.
Beuys, Barbara (2014): Die neuen Frauen – Revolution im Kaiserreich: 1900–1914. Lizenzausgabe Bundeszentrale politische Bildung: Bonn.
Blum, Rebekka (2019): Angst um die Vormachtstellung: Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus. Marta Press: Hamburg.
Butler, Judith (1990): Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge: New York.
Casale, Rita/Rendtorff, Barbara [Hrsg.] (2008): Was kommt nach der Genderforschung? Zur Zukunft der feministischen Theoriebildung. Transcript: Bielefeld.
Degele Nina (2003): Happy together: Soziologie und Gender-Studies als paradigmatische Verunsicherungswissenschaften. In: Soziale Welt, 54, Heft 1, S. 9–29.
Dohm, Hedwig (1902): Die Antifeministen: Ein Buch der Verteidigung. Dümmler: Berlin.
Frank, Karsta (1996): Political Correctness: Ein Stigmawort. In: Diekmannshenke, Hans-Joachim/Klein, Josef [Hrsg.]: Wörter in der Politik. Analysen zur Lexemverwendung in der politischen Kommunikation. VS: Opladen, S. 185–218.
Fraser, Nancy (2016): Contradictions of Capital and Care. In: New Left Review, Heft 100, S. 99–117.
Frietsch, Elke/Herkommer, Christina (2009): Nationalsozialismus und Geschlecht: eine Einführung. In: Dies. [Hrsg.]: Nationalsozialismus und Geschlecht. Zur Politisierung und Ästhetisierung von Körper, ‚Rasse‘ und Sexualität im ‚Dritten Reich‘ und nach 1945. Transcript: Bielefeld, S. 9–48.
Gerhard, Ute (1994): Die staatlich institutionalisierte „Lösung“ der Frauenfrage: Zur Geschichte der Geschlechterverhältnisse in der DDR. In: Kaelble, Hartmut/Kocka, Jürgen/Zwahr, Hartmut [Hrsg.]: Sozialgeschichte der DDR. Klett-Cotta: Stuttgart, S. 383–404.
Hausen, Karin (1976): Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“: Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben. In: Conze, Werner [Hrsg.]: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Klett: Stuttgart, S. 363–393.
Herman, Eva (2006): Das Eva-Prinzip: Für eine neue Weiblichkeit. Pendo: Zürich.
von Hindenburg, Barbara (2018): Die Auswirkungen des Frauenwahlrechts in der Weimarer Republik. Online:
www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/frauenwahlrecht/279340/auswirkungen-des-frauenwahlrechts [28.11.2019].
Kemper, Andreas (2016): Antiemanzipatorische Netzwerke und die Geschlechter- und Familienpolitik der Alternative für Deutschland. In: Häusler, Alexander [Hrsg.]: Die Alternative für Deutschland: Springer VS: Wiesbaden, S. 81–97.
Laqueur, Thomas (1992): Auf den Leib geschrieben: Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud. Campus: New York.
Linkerhand, Koschka [Hrsg.] (2018): Feministisch streiten. Texte zu Vernunft und Leidenschaft unter Frauen. Querverlag: Berlin.
Maihofer, Andrea/Schutzbach, Franziska (2015): Vom Antifeminismus zum ‚Anti-Genderismus‘. In: Hark, Sabine/Villa, Paula-Irene [Hrsg.]: Anti-Genderismus. Transcript: Bielefeld, S. 201–218.
Maurer, Susanne (2018): Hedwig Dohms ‚Die Antifeministen‘. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 68, Heft 17, S. 40–46.
Metzler, Gabriele/Schumann, Dirk (2016): Unübersichtlichkeit und Machtverschiebungen: Perspektiven der Geschlechter- und Politikgeschichte der Weimarer Republik. In: Dies. [Hrsg.]: Geschlechter(un)ordnung und Politik in der Weimarer Republik. Dietz: Bonn, S. 7–30.
Otto, Louise (1849):
Programm. In: Frauen-Zeitung. Ein Organ für die höheren weiblichen Interessen. Nr. 1 vom 21.4.1849, S. 1. Online: digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/276181/ [19.02.2020].
Planert, Ute (1998): Antifeminismus im Kaiserreich: Diskurs, soziale Formation und politische Mentalität. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen.
Plötz, Andy (2014):
Queer Politics. In: Gender Glossar. Online: gender-glossar.de/glossar/item/37-queer-politics [19.02.2020].
Redecker, Eva von (2016): Anti-Genderismus and right-wing hegemony. In: Radical Philosophy, Heft 198, S. 2–7.
Sauer, Birgit (2019): Anti-feministische Mobilisierung in Europa: Kampf um eine neue politische Hegemonie? In: Zeitschrift für vergleichende Politikwissenschaften, 13, Heft 3, S. 339–352.
Schenk, Herrad (1980): Die feministische Herausforderung: 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland. Beck: München.
Schmincke, Imke (2018): Frauenfeindlich, sexistisch, antifeministisch? Begriffe und Phänomene bis zum aktuellen Antigenderismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 68, Heft 17, S. 28–33.