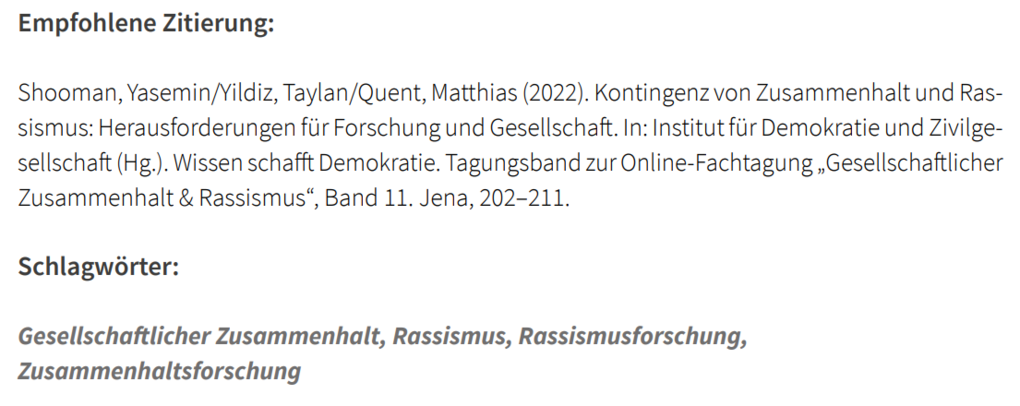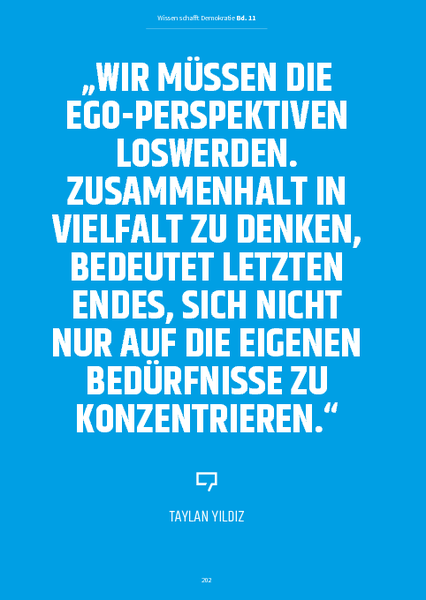Matthias Quent:
Ist Rassismus eine Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil er die Menschenwürde des Einzelnen infrage stellt oder ist es nicht eigentlich so, dass Rassismus die Gesellschaft zusammenhält, zum Beispiel, indem er von massiver nationaler, globaler und sozialer Ungleichheit ablenkt und diese rechtfertigt? Man könnte auch fragen: Wie rassistisch ist eigentlich der Status quo des gesellschaftlichen Zusammenhalts?
Yasemin Shooman:
Für mich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Wie lässt sich Zusammenhalt operationalisieren? Das gilt auch für die Rassismusforschung: Lässt sich Rassismus messen? Aber beim Rassismus liegt die Operationalisierung dieser Messbarkeit näher. Beim gesellschaftlichen Zusammenhalt hingegen frage ich mich: Wie messe ich das in einer Gesellschaft? Um die Frage zu beantworten, ob gesellschaftlicher Zusammenhalt schon per se etwas ist, bei dem man gegen andere zusammenhält: Ich glaube, es kann beides sein. Wir können eine Ideologisierung des Begriffs mit ausgrenzendem Effekt nachweisen und in vielen politischen Kontexten vorfinden. Besonders ausgeprägt ist das bei der Neuen Rechten und im Rechtspopulismus, aber es gibt auch andere politische Verwendungen. Doch ich finde die Frage schwer zu beantworten, weil mir noch die Fantasie fehlt, wie man Zusammenhalt misst; davon hängt auch ab, wie sich das zu Rassismus verhält.
Taylan Yildiz:
Rassismus ist definitiv eine Gefahr und keines jener Ismen, die wir für den Zusammenhalt in modernen Gesellschaften akzeptieren könnten. Gleichwohl kenne ich die Diskussion im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, wo es ja auch oft um die Ambivalenzen des Zusammenhalts geht. Ich denke, dass man unterschiedliche Formen des Zusammenhalts voneinander unterscheiden muss. Auch der Rassismus ist ein Phänomen, in dem zusammengehalten wird. Er geht aber mit einer Art „Zusammenhaltsfetisch“ einher, wie das auch in Sekten oder kriminellen Banden der Fall ist. Das ist eine extreme Form, die vor allem durch radikale Ein- und Ausgrenzung funktioniert. Wenn man aber die Ebene der Gesellschaft betrachtet und von den Bindungsmodalitäten in Kleingruppen absieht, dann ist Zusammenhalt eher Vielfaltsmanagement. Die Gesellschaft ist ausdifferenziert, wir leben unter sozialen und kulturellen Bedingungen, in der wir Zusammenhalt nicht anders denken können als in Relation zu Heterogenität und Vielfalt – auch wenn das noch allzu oft negiert wird.
Matthias Quent:
Taylan, wie siehst Du die Frage nach der Messung dieser Phänomene? Kann man das Machtverhältnis von Rassismus empirisch fassen, beispielsweise im Rahmen von Einstellungsbefragungen? Das Gleiche gilt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine erste Betrachtung, die wir im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt angestellt haben, beschäftigte sich mit der Verwendung des Begriffs des Zusammenhalts in den Medien. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es eher als ein macht- oder herrschaftsstabilisierendes Konzept angewandt wird. Wie kann man solche Reflexionen in beide Bereiche einfließen lassen? Wo gibt es Spannungen, aber auch Bereicherungsmöglichkeiten?
Taylan Yildiz:
Rassismus über Einstellungsforschung allein zu erheben oder zu messen, das geht nicht. Das tut dem Gegenstand keinen Gefallen, weil Rassismus weit mehr umfasst, als es das Antwortverhalten von Probanden zu sehen erlaubt. Gleichwohl glaube ich aber, dass es unheimlich wichtig ist, Rassismus zu messen, weil wir eine Vorstellung davon brauchen, wie sich rassistische Einstellungsmuster in der Gesellschaft verteilen. Jede Zustandsbeschreibung von Rassismus bliebe unvollständig, wenn wir keine Kenntnis davon hätten, wie sich die Gesellschaftsmitglieder dazu kognitiv verhalten. Da ist die Einstellungsforschung vielleicht nicht das ultimative Tool, aber sie hat sich gut bewährt und schafft es, Diskussionen über Rassismus anzustoßen und eine Signalwirkung zu entfalten. Geht man dem Gegenstand Rassismus allerdings phänomenologisch nach, wird man eingestehen müssen, dass wir darüber hinaus sowohl die Betroffenenperspektiven einbeziehen müssen als auch jene Aspekte, die auf eine systemische Qualität des Rassismus verweisen. Stellt man sich die Frage, wie man sich Rassismus von seiner Seins-Art vorstellen kann, dann können wir uns Rassismus entweder wie tektonische Platten vorstellen, die in ihrer Materialität vollumfänglich greifbar sind, oder wir stellen uns Rassismus als etwas vor, das sich eher, wie Cornelius Castoriadis das mal gesagt hat, wie Magma bewegt – also etwas Verfilztes ist, ein Gewebe, das schwer zu durchdringen ist. Wenn wir uns an die Debatten zu biologischem Rassismus der 70er/80er-Jahre erinnern, zum kulturellen Rassismus und zum Rassismus ohne Rassen, dann sehen wir schon recht deutlich, dass Rassismus etwas ist, das sich in seiner Existenz-Form wandeln kann. In der Einstellungsforschung aber wird vorausgesetzt, dass wir Rassismus als etwas Stabiles behandeln und mit operationalisierender Ausrichtung definieren können – eben wie tektonische Platten, die man vermisst. In dem Moment aber, in dem man sich in die Praxis bewegt und die Erfahrungen mit Rassismus in die Bilanzierung aufnimmt, wird man den Gegenstand eher als etwas Magma-Artiges erfahren. Es gibt gewisse Äußerungen und Artikulationen, die würde man in der Einstellungsforschung als rassistische Artikulation kennzeichnen, doch in der Mikroperspektive des Alltages ergibt sich das nicht immer. Rassismus kann in bestimmten Diskurskontexten unsichtbar bleiben und sich auf den vorkognitiven Bereich beschränken, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Ebenso gut können bestimmte Artikulationen, die wir als rassistisch qualifizieren würden, in Wirklichkeit andere Motivbezüge haben. Das Feld ist also sehr komplex, birgt viele Verwechslungsgefahren und wenn man den Ambivalenzen Rechnung trägt, merkt man, dass Vieles nahtlos ineinander übergeht.
Matthias Quent:
In Hinblick auch auf die verschiedenen Machtdimensionen und die Frage der Messbarkeit ist es also notwendig, von Rassismen zu sprechen – statt von Rassismus. Yasemin, wie ist Dein Zugang?
Yasemin Shooman:
Zunächst würde ich zustimmen, dass es eine Selbstverständlichkeit für alle ist, die sich in der Rassismusforschung verankern, die Einstellungsforschung, also die Ebene von Individuen und Vorurteilen, nur als ein Mosaikstück zu betrachten. Denn zu messen, wie sehr solche Einstellungen handlungsleitend werden, wie sehr Rassismus als ein Ordnungs- und Strukturprinzip der Gesellschaft begriffen werden muss und wie sehr spezifische Gruppen in einer spezifischen Weise auf verschiedenen Ebenen von Regulation und Ausschlussmechanismen betroffen sind, das braucht weitere methodische Ansätze. Es ist kein Zufall, dass die Rassismusforschung in Deutschland eine sehr qualitativ geprägte Forschungslandschaft ist. Es fehlen uns aber repräsentative Daten. Es ist klar, dass wir die Arbeitsmarktforschung, das Bildungssystem, also die großen Politik- und Handlungsfelder, hinsichtlich der Reproduktion rassistischer Ausschlüsse abfragen können und müssen. Für uns ist beim Rassismusmonitor eine Annäherung aus verschiedenen Perspektiven sehr wichtig, darunter ganz zentral die Betroffenenperspektive. Es geht einerseits darum, auf einer subjektiven Ebene Erfahrungen abzubilden und somit die ganze Alltagsdimension von Rassismus darzustellen. Die Dimension, für die Philomena Essed den Begriff Alltagsrassismus geprägt hat, ist lange Zeit nicht im Fokus gewesen. Gleichzeitig darf man bei diesen subjektiven Wahrnehmungen nicht stehen bleiben, sondern muss sie mit anderen Ansätzen und Forschungsdesigns kombinieren, beispielsweise Experimenten, die Diskriminierung nachweisen. Für den Arbeitsmarkt gibt es einige Studien, die durch Interviews mit sogenannten Gatekeepern zeigen, wie der Ausschluss von Personen rationalisiert wird, auch wenn das keine intentionalen Handlungen sind. Wenn wir die Effekte von nicht intentionalem, routiniertem Handeln sehen, das sich auch in institutionellen Logiken widerspiegelt, dann ist klar, dass wir andere Ansätze brauchen, um das zu erforschen. Um einen weiten und multiperspektivischen Blick auf die Untersuchungsgegenstände werfen zu können, braucht es zudem stark partizipative und kollaborative Ansätze. Die Beschäftigung mit diesem Thema war viele Jahre ein Bottom-Up-Prozess und vor allem von denjenigen forciert und vorangebracht, die selbst mit Rassismus konfrontiert sind. Das heißt, es ist unabdingbar, dieses Erfahrungswissen, das sich in den Communitys findet, als eine Ressource zu sehen, wenn man diese Forschung nicht auf tönerne Füße stellen möchte.
Matthias Quent:
Das erste Mal, dass die Bundesregierung offiziell über Rassismus gesprochen hat, war, in diesem Ausmaß zumindest, mit dem Bundeskabinett gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Wann habt Ihr in Euren persönlichen wie auch akademischen Erfahrungen und Laufbahnen festgestellt, dass Ihr über Rassismus sprechen und diesen Begriff benutzen könnt?
Taylan Yildiz:
Es ist ein sehr junges Phänomen. Man könnte mal schauen, in wie vielen Fachzeitschriften der Begriff Rassismus fällt und wann es wirklich ein akademisches Thema jenseits postkolonialer Forschungen und biografischer Notizen wurde. Persönlich war es für mich schon immer ein Thema. Aber der Status von Subjektivität in der Wissenschaft ist ja umstritten. Es gibt Forschungsperspektiven, die die Auffassung vertreten, dass Subjektivität in der Forschung überhaupt nichts zu suchen hat, Forschung möglichst objektiv sein sollte. Und es gibt die andere Perspektive, die der Subjektivität eine wichtige Rolle zuspricht. Da besteht eine Spannung, doch wenn man sich jenseits dieser methodologischen Grabenkämpfe mehr am Gegenstand orientiert, kann es vielleicht gelingen, eine Verbindung zu finden – und das ist eine große Möglichkeit im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, über diese Gräben hinweg, am Gegenstand eine Verbindung und eine Diskussion zu finden. Die wird wahrscheinlich nicht so laufen, dass am Ende alle der gleichen Meinung sind, doch über den akademisch-kultivierten Streit lässt sich über den Gegenstand doch einiges in Erfahrung bringen. Ich habe den Eindruck, dass erst seit dem Aufdecken vom NSU und der Ermordung Walter Lübckes das Thema Rassismus in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen und das politische Bedürfnis nach wissenschaftlicher Einordnung damit gestiegen ist. Dass man solche Tagungen abhalten und die Stimmenvielfalt vergrößern kann, war nicht immer so. Wenn man in den 1990er-Jahren mit einem sichtbaren Migrationshintergrund das Thema Rassismus adressiert hat, hieß es immer, dass sich das nicht auf die Gesellschaft als Ganzes beziehen ließe, da die Eindrücke doch viel zu subjektiv und wenig verallgemeinerungsfähig wären. In dieser Zeit, in der ich aufgewachsen bin, stehen in meiner Erinnerung die ersten großen Vorfälle mit rassistischem Bezug: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Lichtenhagen und dergleichen. Da hatte man echt Probleme, sich mit einem gewissen Gastarbeiter-Hintergrund als Deutscher zu identifizieren. Das war eine schwierige Zeit. In der allgemeinen Wahrnehmung damals aber waren diese Vorfälle Relikte der Vergangenheit, die noch einmal in die Jetztzeit reinschlagen. Das änderte sich erst mit dem NSU, der Tötung der Polizistin und der Tötung von Walter Lübcke. Und auf einmal ist es kein Relikt der Vergangenheit mehr, sondern rückt in der Imagination in die Zukunft. In den letzten zwei Jahren ist das Gespür für Rassismus stärker geworden, man spricht anders darüber, weil das Reden über Rassismus selbst noch mal ein anderes Verständnis erzeugt und sich vor einem anderen Wahrnehmungshintergrund vollzieht. Auch die Sprecherpositionen sind ganz anders. Zudem ist heute die Sozialwissenschaft anders aufgestellt als in den 90er-Jahren. Das hat in meiner Wahrnehmung auch etwas damit zu tun, dass man die Dringlichkeit anders einstuft.
Matthias Quent:
Yasemin, eine andere Dringlichkeit, ein gewachsenes Bewusstsein, politische Veränderung oder wissenschaftlicher Fortschritt – wo würdest du die Ursprünge der konsensualen oder zumindest der im Mainstream angekommenen Rassismus-Terminologie ansiedeln?
Yasemin Shooman:
Wir sollten uns daran erinnern, seit wann die Politik von Rassismus spricht. Bis auf der Ebene der Bundesregierung wirklich von Rassismus die Rede war, hatten wir bereits eine Debatte, und zwar 2010, als die damalige Familienministerin Kristina Schröder eine große Rassismus-Debatte anstieß. In dieser Debatte ging es um Deutschenfeindlichkeit als eine Form des Rassismus, um einen „anti-weißen“, „antideutschen“ Rassismus. Das finde ich schon deswegen bemerkenswert, weil es zeitlich in das gleiche Jahr wie Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ fällt. Damals herrschte keinesfalls Konsens darüber, dass Sarrazins Äußerungen rassistisch sind, obwohl eine Verknüpfung von kulturrassistischen Argumentationen mit biologistischen Argumentationen in diesem Buch vorhanden war. Aus Frankreich kennt man eine ähnliche Diskussion zum sogenannten „racisme anti-blanc“. Das zeigt, dass solche Backlashes immer wieder kommen. Es geht nicht darum, ethnische Vorurteile und Mobbing, die unter dem Stichwort Deutschenfeindlichkeit gefasst werden, als soziale Phänomene zu verharmlosen. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn auf der Ebene der Bundespolitik so eine breite Rassismus-Debatte geführt wird, die die Frage nach Machtaspekten innerhalb einer Gesellschaft und der strukturellen Dimension von Rassismus völlig ausklammert? Wir sind weitergekommen an manchen Stellen, aber das ist keine lineare Entwicklung. Ich finde es beeindruckend, wie der rassistische Mord an George Floyd viele Menschen in Deutschland mobilisiert hat. Die Aufdeckung des NSU hat damals nicht so viele Menschen auf die Straße gebracht wie „BlackLivesMatter“, vielleicht, weil es leichter ist, sich mit einem im Ausland verorteten Rassismus auseinanderzusetzen. Insofern bin ich noch ein bisschen skeptisch, inwieweit der NSU tatsächlich einen gesamtgesellschaftlichen Turning-Point darstellt. Aber mit #BlackLivesMatter, mit Halle, Hanau und dem Kabinettausschuss haben wir eine massive Zäsur erlebt. Wir wären jetzt nicht hier, auch nicht in diesen institutionellen Zusammenhängen, wenn es nicht diesen politischen Auftrieb gegeben hätte, eine Forschungsagenda zu Rassismus mit Support von ganz oben zu pushen.
Auf der anderen Seite werden wir eine stärkere Ausdifferenzierung erleben. Meine Vermutung ist, dass der klassische, aus den USA übernommene Rassismus-Begriff es einfacher hat, auf Akzeptanz zu stoßen, weil die Leute das verstehen. Das heißt nicht, dass die Menschen weniger rassistisch denken und handeln, aber man sieht zum Beispiel in der Mitte-Studie, dass es bei der Ablehnung verschiedener Gruppen immer noch einen Gap gibt zwischen Sinti*zze und Rom*nja, Muslim:innen und Schwarzen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die Leute gelernt haben, dass der color-line-basierte Rassismus gegen Schwarze sozial nicht erwünscht ist. Das sagt gar nichts darüber aus, wie verbreitet dieser Rassismus tatsächlich ist. Doch unterliegt er inzwischen einer gewissen Tabuisierung. In Bezug auf andere Codes und Begründungszusammenhänge, die eher von einem kulturellen Determinismus ausgehen, der sich auch mit Religion mischt, stehen wir noch relativ weit am Anfang. Auch unter Forschenden ist da noch Bedarf für eine breitere Auseinandersetzung. Schon vor mehr als zehn Jahren, als die deutsche Islamkonferenz die Themen Abwertung, Ausgrenzung und Stigmatisierung von Muslim:innen und muslimisch gelesenen Menschen auf die Agenda gesetzt hat, gab es Begriffsdiskussionen. Die Rassismusforschung und deren Erkenntnisse sind da nicht mit eingeflossen, stattdessen wurde ein sehr enges Verständnis von Rassismus bemüht. Folglich wurde von Muslimfeindlichkeit gesprochen und Rassismus blieb eher für das reserviert, was Neonazis machen oder was die Nazis in der Vergangenheit gemacht haben. Dieses Verständnis ist inzwischen an vielen Stellen aufgebrochen, aber bei einigen Formen des Rassismus, Stichwort Sarrazin, ist es nach wie vor oft so, dass diese spezifischen Formen von Rassismus, die sich sehr stark auf Kultur und eine Rassifizierung kultureller und religiöser Zugehörigkeit beziehen, nicht in Beziehung mit Rassismus als Überphänomen betrachtet werden. Da liegt noch einiges an Arbeit vor uns.
Matthias Quent:
Im Gespräch mit Aladin El-Mafaalani wurde formuliert, dass die Demokratisierung des Rassismus-Diskurses dafür zu sorgen scheint, dass die Begriffsverwendung in Hinblick auf das Niveau etwas einfacher, salopp gesagt, etwas dümmer wird. In eine ähnliche Richtung geht eine Frage aus dem Publikum: Wie kann angesichts der Ausbreitung der Forschung zu Rassismus gewährleistet werden, dass der Rassismus-Begriff nicht vollkommen unscharf wird? Wie kann eine Aneignung des Begriffes verhindert werden? Gibt es Mindeststandards für die Rassismusforschung, die über die üblichen Qualitätsstandards von wissenschaftlichen Arbeiten hinausgehen sollten, gerade wenn sich Menschen damit beschäftigen, die sich vielleicht vorher noch nie mit Rassismus-Theorien, Kritik oder Forschung auseinandergesetzt haben?
Yasemin Shooman:
Eine Verwässerung lässt sich nicht per se verhindern. Es wird jetzt darum gehen, sich stärker über Arbeitsdefinitionen auszutauschen. Vielleicht schärft das die eigene Theoriearbeit. Das Problem ist, meiner Erfahrung nach, dass Theoriearbeit vielfach nicht richtig stattfindet. Es wird eigentlich zu wenig zum Gegenstand gemacht, das noch mal zu reflektieren, dabei ist das eigentlich eine Chance. Es fehlt im Arbeitsalltag wahrscheinlich auch der Rahmen dafür, aber bei großen Projektvorhaben wird man zur Einsicht kommen, dass es zwar nicht die eine alles abdeckende Arbeitsdefinition gibt, aber dass man mehr über Arbeitsdefinitionen sprechen muss. Zu der Frage, was ein Standard guter wissenschaftlicher Praxis für die Rassismusforschung wäre: Wichtig finde ich, wie sich partizipative und kollaborative Ansätze gut umsetzen lassen. Für mich bedeutet das, in einer Institution zu schauen, wie das Personal aufgestellt ist, wer die Forschenden sind. Sind es sehr homogene Teams oder gibt es eine Heterogenität an Perspektiven, Disziplinarität und Erfahrungshorizonten mit Rassismus? Wie sieht es mit den Gremien aus, die wir als Begleitung für diese Forschung aufstellen? Solche Prozesse sind sehr aufwendig – da geht es um wechselseitigen Austausch, es geht darum, Forschungsdesigns von Anfang an gemeinsam zu entwickeln, communitybasiertes Wissen mit einfließen zu lassen und sich zu überlegen, wie das funktionieren kann, ohne massive Hierarchien zwischen Forschenden und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu reproduzieren. Auf der anderen Seite müssen bestimmte methodische Standards eingehalten werden, auch weil diese Forschung als sehr politisiert wahrgenommen wird. Es gibt den Vorwurf, dass sie ideologischer, parteiischer und aktivistischer sei als andere Forschung. Hier wird es stark darauf ankommen, methodisch wasserfest zu arbeiten und hohe Qualitätsstandards zu setzen und einzuhalten. Weiterhin muss man transparent sein, wenn man Ergebnisse in den politischen und öffentlichen Raum kommuniziert. Das sind Punkte, von denen ich denke, dass sie bei diesem Forschungsgegenstand noch viel stärker als bei anderen eine Rolle spielen. Da täte es allen Institutionen gut, den machtkritischen Aspekt, der im Gegenstand angelegt ist, selbstreflexiv in Bezug auf die Forschungsdesigns und die Zusammenstellung der Forschenden einzusetzen.
Matthias Quent:
Das sind nicht nur akademisch anspruchsvolle, sondern vor allem ressourcenaufwendige Anforderungen, die du hervorgehoben hast in Abgrenzung bzw. in Kontrastierung zu anderen Aufgaben. Es muss auch in Hinblick auf die Forschungsfinanzierung und -förderung deutlich kommuniziert werden, dass diese Forschung sowohl in Hinblick auf den Zeitaufwand als auch auf den Ressourcenaufwand längere Arbeiten und gründlichere Verankerungen, Beziehungsarbeit, Einbeziehung und Partizipation voraussetzt.
Taylan Yildiz:
Auf der einen Seite ist die Vereinnahmung des Rassismus-Begriffs meiner Ansicht nach leicht dechiffrierbar. Ob diejenigen, die rassistische Begriffe vereinnahmen, dann aufhören, das zu tun, ist eine andere Sache. Auf der anderen Seite ist besonders wichtig: die Art der partizipativen Forschung, der Vernetzung mit lokalem Wissen und Akteuren aus dem Feld – all das, was üblicherweise unter Transfer verbucht wird. Das halte ich für wichtig und das ist natürlich sehr ressourcenaufwendig, aber da tut sich einiges.
Matthias Quent:
Wie kann nun ein Zusammenhalt beschrieben und hergestellt werden, der 0% rassistisch ist? Und wie kann vermieden werden, dass andere Ersatzabwertungen versuchen, die Rechtfertigungsfunktion von Rassismus zu ersetzen?
Taylan Yildiz:
Ich kann es ganz kurz machen: Wir müssen die Ego-Perspektiven loswerden. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Zusammenhalt in Vielfalt zu denken, bedeutet letzten Endes, sich nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Das hat vielleicht einen esoterischen Klang, aber wenn man in Vielfalt zusammenhalten will, muss man sich in andere Personen und Strukturen mit einer gewissen selbstkritischen Distanz hineinversetzen können und am Ball bleiben.
Yasemin Shooman:
Ich kann mich anschließen: Den Blick immer wieder auf Strukturen zu richten, ist sehr wichtig. Das ist schwer, weil es abstrakter ist, als individuelle Ebenen zu betrachten. Ansonsten ist das gerade erst der Beginn einer Konversation und insofern: to be continued. Ich freue mich auf den Austausch zwischen dem „Rassismusmonitor“ bei uns am DeZIM und den Rassismus-Projekten des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt und denke, das sollten wir auf jeden Fall fortsetzen.