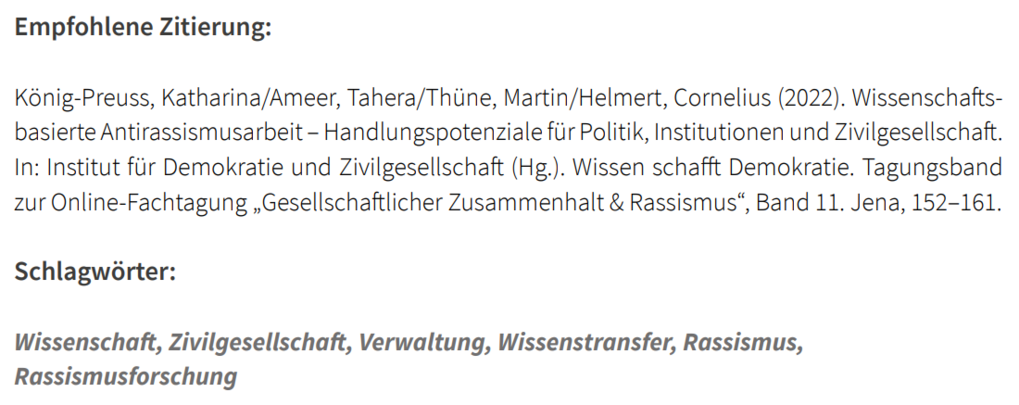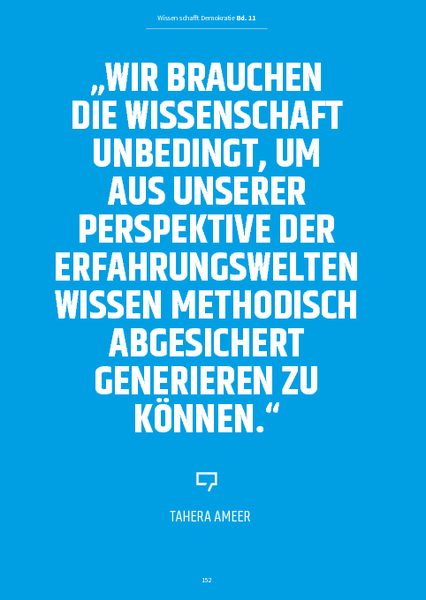Cornelius Helmert:
Ich möchte direkt einsteigen und Katharina König-Preuss als damaliges Mitglied der Thüringer Enquete-Kommission Rassismus fragen: Können Sie zu Beginn einordnen, wie es zur Enquete-Kommission kam, was die Idee dahinter war und vor allem, wie dort die Zusammenarbeit funktioniert hat?
Katharina König-Preuss:
Die Enquete-Kommission Rassismus war eine Folge aus den beiden NSU-Untersuchungsausschüssen. Die Idee: mit einer Enquete-Kommission Rassismus – und das sehr bewusst in einer Enquete-Kommission, um Wissenschaft, aber auch Sachverständige zu beteiligen – zu versuchen, an die Ursachen heranzugehen und Definitionen für Politik festzulegen. Die Kommission hat ein bisschen mehr als zwei Jahre mit Wissenschaft und Praxis, in Form von Sachverständigen-Anhörungen, gearbeitet. Aber wir hatten zum Beispiel auch die Landes-Schulelternsprecher:innen eingeladen, um zu erfahren, wie an Schulen mit rassistischen Vorfällen umgegangen wird und an welchen Stellen sich Lücken im Umgang, in der Behandlung, in der Sensibilisierung und überhaupt erst in der Wahrnehmung finden. Ich selbst habe viel gelernt in dieser Enquete-Kommission. Bis heute bin ich den Wissenschaftler:innen dankbar, die über zwei Jahre sehr viel Zeit investiert haben. Der Abschlussbericht hat sehr viele Maßnahmen für alle möglichen Bereiche empfohlen. Und jetzt kommt das Problem: Die Maßnahmen werden bis heute nicht umgesetzt. Es gibt vereinzelte Maßnahmen, die in die Umsetzung gekommen sind, mit sehr viel Druck aus der Politik. Das beste Beispiel dafür ist die unabhängige Anti-Diskriminierungsstelle, die es mittlerweile seit einigen Monaten in Thüringen gibt. Aber man muss schon sagen, dass die absolute Mehrheit der Maßnahmen nicht umgesetzt wurde und vermutlich auch erst mal nicht umgesetzt wird. Und das hat vor allem etwas mit Verwaltungshandeln auf Regierungsebene zu tun und mit einer fehlenden Priorisierung. Es wird einfach nicht ernst genommen, dass diese Maßnahmen mehr sind als ein politisch-wissenschaftliches Dokument. Ich finde, dass die rot-rot-grüne Landesregierung schon längst viel mehr hätte tun können. Und dazu muss man wissen, dass nur ein Teil der Maßnahmen überhaupt Geld benötigt. Bei vielen Maßnahmen geht es um ein anderes Handeln, um einen sensibilisierten Umgang und ein anderes Verständnis. Es ist erschreckend, dass das nicht gemacht wird und man fragt sich schon, welchen Sinn es noch hat, sich in unterschiedlichen Formen einzusetzen, wenn es Beschlusslagen gibt und diese nicht umgesetzt werden.
Cornelius Helmert:
Gibt es aus Ihrer Sicht bei der Zusammenarbeit in Form einer Enquete-Kommission Unterschiede zum sonstigen politischen Betrieb, in dem ja durchaus auch wissenschaftliche Perspektiven einbezogen werden?
Katharina König-Preuss:
Ja, einen großen, weil Politik sich aus Wissenschaft immer gern die Bereiche rauszieht, die dem eigenen politischen Handeln oder der eigenen Position entsprechen. Das bedeutet, dass die Parts der Wissenschaft ausgeblendet werden, die möglicherweise im Widerspruch stehen – und das ist ein Unterschied zur Enquete-Kommission, weil die Wissenschaft hier direkt beteiligt ist. In dem Moment, wo Politik nur bestimmte Parts auswählt, steht der konsequente Widerspruch und der Verweis auf wissenschaftliche Studien, auf Ergebnisse sofort im Raum. Und das hat man aus meiner Sicht auch in der Enquete-Kommission gemerkt, dass Politik sich in Teilen sehr zurückgehalten hat – zum einen aufgrund fehlenden Wissens, zum anderen aber auch aufgrund einer Debattenebene, die ein Stück versachlichter war. Zwischen CDU, Rot-Rot-Grün und den jeweiligen Sachverständigen gab es eine Zusammenarbeit, die im sonstigen parlamentarischen Raum so nicht existiert.
Cornelius Helmert:
Sie haben kürzlich im Rahmen des zehnten Jahrestages der Selbstenttarnung des NSU einen Maßnahmenkatalog herausgebracht, in der unterschiedliche Forderungen erhoben wurden, die teilweise auch auf die Enquete-Kommission Bezug nehmen. Ich möchte die Forderung herausgreifen, dass der öffentliche Dienst diverser werden muss. Was meinen Sie damit und haben Sie konkrete Vorschläge, wie das geschehen kann?
Katharina König-Preuss:
Die Bediensteten im öffentlichen Dienst kommen mehrheitlich aus einer gesellschaftlichen Gruppe. Ich sage es mal platt: Es sind weiße, in Deutschland aufgewachsene Deutsche. Und damit sind natürlich von vornherein nur bestimmte Perspektiven vorhanden, oft ist überhaupt kein Verständnis da, dass Menschen, die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind, auf Probleme im Raum der öffentlichen Verwaltung stoßen – natürlich auch im Rest gesellschaftlichen Lebens, aber eben auch im Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung. Die Hoffnung wäre, dass es aufgrund einer erhöhten Diversität eine Möglichkeit gibt, die Verwaltung offener, niedrigschwelliger, zugänglicher und für alle Menschen in Deutschland ansprechbarer zu machen. Zugleich möchte ich ein Stück weit davor warnen, dass sich Diversität auf Hautfarben begrenzt. Ich denke, es geht um viel mehr. Leider ist das Verständnis bei den Ministerien oft so, dass sie denken, wenn sie einen Mitarbeiter:eine Mitarbeiterin haben, die von Rassismus betroffen ist, wären damit alle Diversitätsansprüche erfüllt. Dem ist aber nicht so und ich glaube, da muss noch viel gearbeitet und nachgesteuert werden, dass sich die Sensibilität in den Regierungsbänken ändert und man eben nicht denkt, in dem Moment, wo People of Color da sind, ist alles erledigt und gut.
Cornelius Helmert:
Herr Thüne, Frau König-Preuss hat die Polizei angesprochen und als ein Beispiel angeführt, wo der öffentliche Dienst diverser werden muss. Ist das eine Forderung, die Sie unterstützen würden?
Martin Thüne:
Das kann ich nur unterstützen, die Verwaltung generell, aber im Besonderen die Polizei ist eher homogen. Das ist eine Kritik, die man äußern muss und es ist an der Zeit, daran etwas zu ändern. Ich sage immer: Wieso stellen wir nicht viel mehr Leute mit unterschiedlichen Berufshintergründen ein, um für die Probleme, die wir haben, andere Perspektiven zu berücksichtigen? Wieso haben wir beispielsweise nicht Soziolog:innen oder Politikwissenschaftler:innen in den Dienststellen? Wieso arbeiten wir nicht stärker mit Sozialer Arbeit zusammen? Warum ist nicht in jeder größeren Polizeidienststelle ein kleiner Stab, und wenn es nur ein, zwei Leute sind, an Menschen, die die Polizeiführung beraten und ganz andere Einblicke geben?
Cornelius Helmert:
Auch Sie wurden in der Thüringer Enquete-Kommission angehört. Wie war Ihre Wahrnehmung in Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik?
Martin Thüne:
Ich fand die Enquete-Kommission und die Arbeit, die dort geleistet wurde, enorm und finde es manchmal schade, dass das gar nicht so in einer breiten Öffentlichkeit rezipiert wird. Es war ein besonderes Setting: also die Zeit, die das Ganze in Anspruch genommen hat, viele Felder, die man sich angeschaut hat, viele Akteur:innen, die einbezogen waren. In der Sitzung, in der ich war, ging es um das Polizeifeld, da waren neben mir unter anderem Polizeigewerkschafter vertreten, dazu die Beratungsinstitution ezra, die in Thüringen hinlänglich bekannt ist, sowie Vertreter:innen aus Berlin von der Initiative KOP, die Fälle monitoren, bei denen Personen Diskriminierung durch Polizei erfahren, vor allem Racial Profiling. Ich fand das sehr spannend, aber die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wurde, war mit einigen Gewerkschaftern schwierig. Da merkt man schon immer wieder, wie groß die Widerstände sind, wie stark die Beharrungskräfte sind und mir kommt es schon manchmal tatsächlich so vor, gerade im Polizeibereich, dass das fast schon so eine Art Kampf zwischen verschiedenen – ja man muss wirklich sagen – Kulturen ist. Also die einen, die alles so lassen wollen, wie es immer war und alle Kritik abbügeln und die Realität ignorieren. Das hat man in der Sitzung sehr gut gemerkt, weil da wurden Fälle geschildert, auch in Thüringen, aus Thüringen heraus, durch die Beratungsinitiative ezra, die ich in Teilen miterlebt habe durch meine dienstliche Tätigkeit, die wirklich stattgefunden haben und dann sitzen dort Leute von Polizeigewerkschaften, die das abstreiten und versuchen eben diejenigen, die das vortragen, verächtlich zu machen. Das war dann ein Punkt, an dem ich die Hand gehoben habe und gesagt habe, dass es so aus meiner Sicht nicht geht. Schließlich gibt es ja auch Studien, es gibt wenig, aber es gibt Material, es gibt viele Schilderungen, viele Initiativen und es liegt so viel auf dem Tisch. Das ist ein Punkt, der mich tatsächlich umtreibt, das ist genau das, was Frau König-Preuss gesagt hat für die Enquete-Kommission, aber das gilt für ganz viele andere Sachen: Wir haben für den Polizeibereich im Bund und in den Ländern so viele Maßnahmenvorschläge seit Jahren und Jahrzehnten auf dem Tisch liegen. Dinge, die man einfach umsetzen könnte, die teilweise nicht mal was kosten, aber man macht es nicht. Ich finde das frustrierend, vor allem für die Betroffenen. Die Enquete-Kommission hat jedenfalls viele gute Empfehlungen gemacht, auch für den Polizeibereich, und wenn ich das abgleiche, muss ich feststellen, dass nichts davon bis jetzt umgesetzt wurde. Ohne jetzt Bashing betreiben zu wollen, waren die Erwartungen auch vieler Wähler:innen an Rot-Rot-Grün hoch und realistisch, aber sie wurden nicht erfüllt. Wir haben diese Regierung jetzt sechs Jahre, also über eine Wahlperiode hinaus schon, und es ist offensichtlich schwierig, sich im politischen Raum überhaupt auf sehr kleine Ziele zu einigen. Das ist schade, denn die Möglichkeiten sind eigentlich gegeben. Und ich muss im Ländervergleich sagen, dass Thüringen eher hinter Standards zurückfällt, die woanders schon etabliert sind.
Cornelius Helmert:
Sie sind an der Schnittstelle sowohl forschend als auch lehrend in der Ausbildung von Polizist:innen tätig und haben als eine indirekte Folge der Enquete-Kommission ein Handlungskonzept zusammen mit Dr. Schellenberg von der LMU München entwickelt. Können Sie erläutern, was Sie da machen und wie Sie da eine wissenschaftliche Perspektive einbringen?
Martin Thüne
Frau Dr. Britta Schellenberg war ebenfalls als Sachverständige eingesetzt und wir haben uns im Rahmen der Enquete-Kommission kennengelernt. Wir haben in der Folge ein Bildungsmodul entwickelt, um im Polizeibereich für Hasskriminalität, Rassismus und Antisemitismus zu sensibilisieren. Das heißt, es geht um Aus- und Fortbildungen innerhalb der Polizei. Wir wollten keinen reinen Theorie-Input machen, weil es schon einiges gibt und man aus der Lernforschung weiß, dass die Effekte relativ schnell wieder verpuffen. Wir haben also ein Planspiel entwickelt und Fälle aufbereitet, die sich tatsächlich so zugetragen haben in Deutschland und in Thüringen. Diese Fälle spielen wir mit den Auszubildenden oder mit Polizeibeamt:innen durch und versuchen u. a., sie zu sensibilisieren, wie sie professionell ermitteln, um Hasskriminalität zu erkennen bzw. statistisch klassifizieren zu können. Ein wesentliches Element dabei ist es auch, dass wir die Teilnehmenden dazu anhalten, verschiedene Rollen einzunehmen. Wir haben unterschiedliche Rollen-Biografien, u. a. auch Betroffenen-Biografien, und wir geben ihnen Zeit und viele Informationen, sich ernsthaft in diese Perspektive zu begeben.
Cornelius Helmert:
Frau Ameer, wie funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft?
Tahera Ameer:
Wir brauchen die Wissenschaft unbedingt, um aus unserer Perspektive der Erfahrungswelten Wissen methodisch abgesichert und nachvollziehbar generieren zu können – also Wissen, das nicht anekdotisch ist oder als anekdotisch abgewertet wird, sondern methodisch abgesichert. Dafür ist Wissenschaft wichtig. Deshalb war es schon immer das Bestreben, mit Wissenschaft eng zusammenzuarbeiten. Es besteht ein wichtiges Bedingungsverhältnis, weshalb es großartig ist, dass die Amadeu Antonio Stiftung und das IDZ gemeinsam einen Ort in direkter Zusammenarbeit geschaffen haben. So lässt sich in ein reziprokes Verhältnis eines Verständnisses gehen – also was wir in der Praxis erleben, was die Forschung erlebt, wie wir das befruchten können und wie wir vielleicht auch ein Forschungsdesign von Anfang an, das sage ich jetzt aus meiner Perspektive, an die Erfahrungen und den Wissensbestand der Zivilgesellschaft anpassen können. Diesen braucht die Zivilgesellschaft als Untermauerung ihres Erfahrungswissens, um politisch wirken zu können.
Cornelius Helmert:
Wie wirkt die Zusammenarbeit in der Praxis? Ist es ein Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Organisationen oder ist es ein lineares Verhältnis, also produziert die Wissenschaft Wissen, das dann an die Zivilgesellschaft weitergegeben wird?
Tahera Ameer:
Grundsätzlich ist es die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft, für Menschen nachvollziehbar zu machen, was passiert. Das Verhältnis sollte nicht linear sein, also nicht in eine Richtung gehen, sondern in einem Wechselverhältnis stehen. Wir haben in den letzten Jahren häufig erlebt, dass z. B. Juden und Jüdinnen abgesprochen wird, dass sie bei Antisemitismus mitreden können, mit dem Argument, sie seien betroffen. Das ist immer wieder ein Argument, das kommt, und das Problem wird erst dann als echt wahrgenommen, wenn es wissenschaftlich beschrieben wird. Das ist natürlich nicht unsere zivilgesellschaftliche Perspektive. Wir brauchen in dem Wechselverhältnis unserer Erkenntnisse, unseres Wissens die wissenschaftliche Sprecherposition – nicht damit die Wissenschaft das sagt, was wir ohnehin sagen, vielmehr damit Wissen abgeglichen wird, weil wir ganz häufig als zivilgesellschaftliche Akteur:innen in einer defensiven Behauptungssituation sind. Wir wollen unser Erfahrungswissen untermauert wissen, um selbst überprüfen zu können, inwieweit unser Erfahrungswissen tatsächlich abbildbar ist. Zugleich ist es eine Illusion, dass die Wissenschaft ein objektives Bild zeichnet, weil auch Wissenschaft sich immer in einem gesellschaftlichen Machtverhältnis positioniert. Es knirscht immer dann, wenn eine Wissenschaftslogik mit einer politischen Logik oder mit einer betroffenen Opferperspektive nicht zusammengeht.
Cornelius Helmert:
Gibt es Wünsche oder Vorschläge an „die Wissenschaft“ in der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft oder Betroffenen-Organisationen?
Tahera Ameer:
Ja, ich wünsche mir Transdisziplinarität. Und das heißt? Für mich heißt das, dass akademische und nicht-akademische Akteur:innen gemeinsam Wissen generieren und im emphatischen Sinne bedeutet das: Zivilgesellschaft ist auch bei der Entwicklung der Fragestellung dabei. Zivilgesellschaft wird nicht befragt nach der Erbringung von Kontakten, sondern die Frage ist auch: Was ist eure Perspektive? Wo seht ihr die Herausforderungen? Grundsätzlich also ist von uns als Zivilgesellschaft immer der Wunsch, dass wir in der Entwicklung der Fragestellung mit dabei sind, dass wir bei der Diskussion und der Entstehung des Forschungsberichtes beteiligt werden, bei der Umsetzung der Forschung und bei den Vorstellungen der Ergebnisse. Wir haben in Zusammenarbeit mit Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern eine Studie zu Homo- und Transfeindlichkeit gemacht und es war ganz klar – wenn wir die Leute nicht selbst beteiligen, die von Homo- und Transfeindlichkeit betroffen sind, und dann in der Erstellung und Präsentation der Ergebnisse diese zivilgesellschaftlichen Akteur:innen und ihre Betroffenenperspektive nicht integrieren, dann ist das kein transformatives Wissen. Die Frage, die uns leitete und die wir schon in der Zusammenarbeit gestellt haben, war also: Wie können wir transformatives Wissen, das heißt gesellschaftlich wirksames Wissen, schaffen? Und das wäre mein großer Wunsch: dass die Forschung selbst darüber reflektiert, wie ihre Haltung dazu ist, und nicht sagt, sie sei objektiv und damit auch nicht politisch involviert.
Cornelius Helmert:
Gesellschaftlich und teilweise auch politisch wird Rassismus häufig mit Rechtsextremismus verbunden und die Problematisierung vor allem bei der extremen Rechten gesehen, bei neonazistischen Chatgruppen oder Demonstrationen. Die wissenschaftliche Studienlage ist aber inzwischen seit Jahrzehnten eine andere: Der aktuelle Thüringen Monitor gibt an, dass über 40 % der Befragten Deutschland als in einem gefährlichen Maß überfremdet sehen. Frau König-Preuss, nehmen Sie diese Fokussierung auf Rechtsextremismus auch wahr? Und inwiefern steht dies der Möglichkeit, Rassismus in der Gesellschaft auf den Grund zu gehen, im Wege?
Katharina König-Preuss:
Es ist ein Problem, dass Rassismus viel zu oft im Bereich der extremen Rechten verortet wird. Dadurch, dass man Rassismus dort verorten kann, macht man sich selbst frei von Rassismus oder hofft zumindest, sich davon frei machen zu können und nicht an die eigenen rassistischen Vorurteile oder an den Rassismus in eigenen Strukturen herangehen zu müssen. Am Beispiel des Thüringen Monitors kann ich konkret sagen: Die Thüringer Politik finanziert seit mittlerweile 21 Jahren jedes Jahr eine Studie, um zu erfahren, wie die Thüringer Bevölkerung eingestellt ist in Bezug auf Demokratie. Die Studie arbeitet seit Jahrzehnten heraus, dass ein großer Teil der Bevölkerung Deutschland für gefährlich überfremdet hält. Vonseiten der Politik folgt die tradierte Reaktion, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der jeder nach politischer Präferenz seinen eigenen Fokus setzt. Dann folgt eine Aussprache im Landtag, in der die Ergebnisse mit der eigenen politischen Haltung reflektiert werden und in Diskurs und oftmals auch in politischen Streit mit dem politischen Gegner übergeht. Das war‘s. Und dann kommt im nächsten Jahr der nächste Thüringen Monitor. Es ist unfassbar, dass zwar Finanzen zur Verfügung gestellt werden, um Analysen und Forschung zu betreiben, dann aber mit den Ergebnissen nichts gemacht wird.
Tahera Ameer:
Das möchte ich unterstreichen. Der wesentliche Punkt ist: Auf was legen wir den Fokus bzw. konkret am Beispiel des Thüringen Monitor: Was wird erhoben und was wird damit gemacht? Das eine ist, den Leuten immer wieder zu erzählen, wie sie eingestellt sind. Aber man muss dann auch Handlungsräume dafür finden, wie Menschen damit umgehen. Aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive brauchen wir dringend eine Forschung, die die Perspektiven der Betroffenen auch in der Forschungslandschaft darlegt. Es muss vollkommen klar sein, dass hier ein Schwerpunkt liegen muss und es nicht „nur“ um Einstellungsforschung gehen kann. Da geht es um politische Bildung, aber da geht es eben auch im Rahmen dieser Forschung darum, diese Perspektiven sichtbar zu machen.
Cornelius Helmert:
Wir haben nun eine umfassende Problemanalyse vorgenommen und ich frage mich: Warum werden beispielsweise die Maßnahmen der Enquete-Kommission Rassismus nicht umgesetzt?
Katharina König-Preuss:
Mein Antwortversuch, gerade in Bezug auf die Maßnahmen der Enquete-Kommission: Es wird nicht als Priorität gesehen. Ich kann es auch an einem anderen Beispiel zeigen: Wir haben für die 2018 beschlossene Studie zur Überprüfung der Todesopfer rechter Gewalt Mittel zur Verfügung gestellt im Thüringer Innenministerium, doch der Auftrag ist immer noch nicht ausgelöst. Das hat nichts mit Geld zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass es kein Forschungsinstitut gibt. Das hat etwas mit dem fehlenden politischen Willen und einer fehlenden Prioritätensetzung zu tun. Und so erkläre ich mir das auch im Bereich der fehlenden Umsetzung der Maßnahmen der Enquete-Kommission Rassismus. Da fehlt die Sensibilisierung, da fehlt der Versuch, die Betroffenenperspektive ernst zu nehmen und dann kommt noch mit ins Spiel: Die Thüringer Landesregierung besteht aus in Deutschland sozialisierten, weißen, gut gestellten Menschen, die vielleicht ab und zu einen linkeren Blick haben, aber die nichts destotrotz keine Betroffenenperspektive in ihr politisches Handeln übertragen. Und das ist ein Problem.
Tahera Ameer:
Dass der politische Wille nicht da ist, hat einen Grund. Das liegt an den Machtstrukturen, an den Machtverhältnissen, an strukturellem Rassismus. Es interessiert niemanden, wie es Menschen geht, die von Rassismus betroffen sind. Man kann sie umbringen und es interessiert immer noch keinen. Deshalb wünsche ich mir, dass wir in der Forschung mehr über diese Betroffenheitssituation sprechen, um vermitteln zu können, wie lebensbedrohlich das jeden Tag in allen Formen ist – und damit meine ich nicht nur physische Gesundheit. So frustrierend das klingt, aber ich werde weiterhin dafür kämpfen und optimistisch bleiben.
Martin Thüne:
Ich würde dazu noch ergänzen: Ich nehme nach wie vor wahr, gerade im Behördenkontext – da meine ich jetzt nicht nur Polizei – dass jeder Vorschlag, der Fortschritte enthält, als Angriff aufgefasst wird, als Fundamentalkritik an den letzten 30, 40 Jahren Behördenarbeit. Wir müssen aber eine positive Denke entwickeln. Wir könnten doch Vorreiter sein, lasst uns zusammensetzen und dann setzen wir tolle Maßnahmen um und sind dann mal nicht hintendran, sondern ganz vorne! Aber wenn man das sagt, fängt man sich häufig ein, das sei illusorisch. Mich würde ja sehr interessieren, wer von den politischen Verantwortlichen und Behörden und auch woanders wirklich die Empfehlungen der Ausschüsse gelesen hat. Und das auch immer mal wieder tut und abgleicht mit der Frage, was davon bisher umgesetzt wurde? Mein Vorschlag: Lasst uns etwas zusammen machen, lasst uns zusammen hinsetzen und einfach vorangehen.